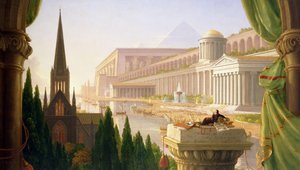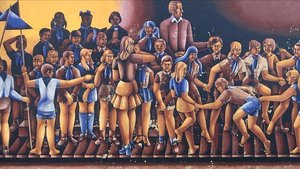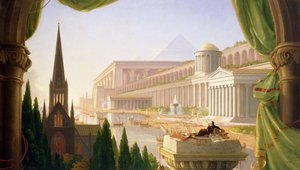Vergangene Semester
Wintersemester 2023/24


Projekt
Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS, B.Sc. Arch. 5. Fachsemester

Seminar
Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik

Vorlesung
Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik

Vorlesung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS

Ringvorlesung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik
Sommersemester 2023
Bewerbung für Thesisarbeiten und freie Projekte
Unsere Professur wird im Laufe des Sommersemesters neu besetzt. Aus diesem Grund bieten wir keine eigenen Thesisentwürfe an. Bewerbungen für Thesen zu eigenen Themen oder freie Projekte sind jedoch auf jeden Fall möglich, wir freuen uns über Ihre Themenvorschläge. Als mögliche wissenschaftliche Themen schauen Sie gerne untenstehende Vorschläge an (Vorschläge folgen). Wir bitten darum eigene Themen vor der Bewerbungsfrist mit Mitarbeitenden des Lehrstuhls vorzubesprechen und abzustimmen. Kontaktieren Sie uns gerne ebenfalls bei Interesse an einem der vorgeschlagenen wissenschaftlichen Themen.
Die Betreuung/Begutachtung von Thesen oder freien Projekten durch Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier ist bis Ende des Sommersemesters garantiert, gerne kann aber dafür auch die Nachfolgerin Prof. Dr. Daniela Spiegel gewählt werden. Kirsten Angermann und Christine Dörner bleiben zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der Professur.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen (bestenfalls nach einer Vorbesprechung dazu, s.o.) bis zum 15.03.2023 per E-Mail als pdf an Susann Zabel, susann.zabel[at]uni-weimar.de (Sekretariat). Zur Bewerbung bitte Lebenslauf, Kurzportfolio (max. 3 Projekte) und ein kurzes Motivationsschreiben einreichen, sowie ein kurzes Exposé/Abstract zum Thema. Bitte nicht vergessen, sich zudem im Online-Portal der Fakultät einzutragen und gleichzeitig den Antrag auf Zulassung zur Thesis im Prüfungsamt bei Frau Schneider einzureichen.
Die Auswahl durch die Professur erfolgt bis spätestens 22.03.2023.
Vorlesung
Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. Architektur
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik, 2. FS. Möglich auch für Studium Generale und B.Sc. Infrastruktur und Umwelt
Blockseminar
Zielgruppe: B. Sc. Architektur, M.Sc. Architektur
Studentisches Bauhaus.Modul
Zielgruppe: Architektur B.Sc. & M.Sc., Urbanistik B.Sc. & M.Sc.
Bauhaus.Modul
Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.

Bauhaus.Modul
Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.
Bauhaus.Modul
Zielgruppe: Die Veranstaltung steht im Rahmen der »Bauhaus.Module« allen Bachelor- und Masterstudierenden der Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien offen.
Ringvorlesung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik
Wintersemester 2022/23
Angebotene Thesisthemen im Wintersemester 2022/23 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte
Vorlesung
Zielgruppe: B.Sc. Architektur 1. FS, B.Sc. Urbanistik
Projekt
Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS, B.Sc. Arch. 5. Fachsemester
Vorlesung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS
Exkursion
Zielgruppe: Bachelor Architektur und Bachelor Urbanistik ab 4. Fachsemester, Master Architektur und Urbanistik
Sommersemester 2022
Angebotene Thesis-Themen im Sommersemester 2022 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte
Vorlesung
Zielgruppe: BA Architektur, BA Urbanistik
Seminar
Zielgruppe: B. Sc. Architektur
Seminar
Zielgruppe: BA Urbanistik, 2. FS
Entwurf
M.Sc. Architektur, B.Sc. Architektur (5. FS und höher)
Exkursion
Zielgruppe: M.Sc. Architektur und Urbanistik, B.Sc. Architektur und Urbanisitk (5. FS und höher)
Wintersemester 2021/22
Angebotene Thesis-Themen im Wintersemester 2021/22 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte
Zielgruppe: Bachelor
Angebotene Thesisthemen im Wintersemester 2021/22 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte
Zielgruppe: Master
Vorlesung
Zielgruppe: B.Sc. Architektur 1. FS, B.Sc. Urbanistik
Projekt
Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik 3. FS
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. Architektur u. B.Sc. Urbanistik je ab 5. FS, M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik
Vorlesung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur 1. FS, M.Sc. Urbanistik 1. FS
Ringvorlesung
Zielgruppe: MA Architektur und Urbanistik
Sommersemester 2021
Übersicht über angebotene Thesis-Themen im Sommersemester 2021 an der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte
Vorlesung
Zielgruppe: B.Sc. Architektur, B.Sc. Urbanistik
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. Architektur
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. Urbanistik, 2. FS.
Seminar
Zielgruppe: B.Sc. I M.Sc. Architektur und Urbanistik
Seminar
Zielgruppe: Master Architektur, Urbanistik, European Urban Studies, IUDD
Bachelor im höheren Semester können bei Interesse teilnehmen
Ringvorlesung
Zielgruppe: MA Architektur und Urbanistik
Bauwerkstatt
Zielgruppe: BA & MA Architektur
Übung
Zielgruppe: M.Sc. Architektur
Projekt
Zielgruppe: M.Sc. Architektur, M.Sc. Urbanistik, maximal 15 Teilnehmende
Wintersemester 2020/21
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Projekt
Denkmalensemble(s) - Möglichkeiten, Grenzen und Alternativen im Umgang mit dem städtebaulichen Erbe
Master Vorlesung
Denkmalpflege und Heritage Management
Master Seminar
Ähnlichkeitserzeugung in der Architektur
Master Thesis
Sommersemester 2020
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Bachelor Seminar
Einführung in die Denkmalpflege
Master Seminar
Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"
Master Projekt
Den Kyffhäuser zurückerobern. Konzepte und Projekte für einen aufgeklärten Tourismus
Master Thesis
Wintersemester 2019/20
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Projekt
Master Vorlesung
Denkmalpflege und Heritage Management
Master Seminar
Sizilien: Drei Jahrtausende Baukultur transkulturell
Master Thesis
Sommersemester 2019
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Bachelor Seminar
Master Seminar
Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"
60plus Icomos Wettbewerb Verkehrsbauten
Master Projekt
Barfüsserkirche Erfurt: Weiterbauen an der Ruine
Master Thesis
Wintersemester 2018/19
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Projekt
» WALK THIS WAY! Ein Audio-Spaziergang für das Bauhaus-Jahr.
» Holzdorf - historische Spuren identifizieren, analysieren, bewerten.
Master Vorlesung
Denkmalpflege und Heritage Management
Master Seminar
Filling the gaps - Forschungsseminar zur regionalen DDR-Architektur
Master Seminar
Ringvorlesung "Identität und Erbe"
Master Workshop
Sommersemester 2018
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Bachelor Seminar
Bachelor Thesis
Kulturhaus Kohlekraftwerk Erfurt
Master Seminar
Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"
Master Projekt / Thesis
Wintersemester 2017/18
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Projekt
Industriekultur in Thüringen: Bestand, Bewertung, Potentiale
Bachelor Thesis
Ein Entwurfskonzept für die Scheune ohne Dach, Schloss Neuenburg: Entwurf
Master Vorlesung
Denkmalpflege und Heritage Management
Master Seminar
Sommersemester 2017
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte II – Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Bachelor Seminar
Buchenwald-Spuren – Diskurs und Konzeption zur Vermittlung
Bachelor Thesis
Bahnhof Hettstedt / Kupferkammerhütte (Mansfelder Bergwerksbahn)
Master Seminar
»60plus XXL« – Plädoyers für die großformatige Spätmoderne
Ringvorlesung Graduiertenkolleg "Identität und Erbe"
Master Projekt
»Ein Gespenst geht um…« – Auf den Spuren des Kommunismus in Weimar
Master Thesis
Wintersemester 2016/17
Bachelor Vorlesung
Architekturgeschichte I – Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Seminar
Historische Baustoffe und Baukonstruktion im Detail
Bachelor Entwurf
Buchenwald in Weimar – Spurensuche im Stadtraum
Bachelor Thesis
Leergut reused. Konversion gewerblich-industrieller Brachen in Erfurt
Ensembles der Spätmoderne – Inwertsetzung und Bewahrung
Master Vorlesung
Sommersemester 2016
Bachelor Vorlesung
Architektur- und Baugeschichte, Teil 2
Bachelor Seminar
Case Study Houses – Entwerferische und energetische Lösungen beim Bauen im Bestand
Stadt als Denkmal
Bachelor Thesis
Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016
Master Seminar
2700 Years of History - Understanding the urban layers of Naples
Bauwerkstatt Moderne – Planerische Interventionen am Baubestand in Halle-Neustadt
Ein Semester „im Holz“ - das Dachwerk als Quelle der historischen Bauforschung
Zollstock, Tachymeter oder Laserscanner? – Bauaufnahme im Kloster Anrode, Thüringen
Master Projekt
Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016
Master Thesis
Weiterbauen im Ensemble. Studentischer Wettbewerb Messeakademie 2016
Wintersemester 2015/16
Bachelor Vorlesung
Architektur- und Baugeschichte, Teil 1: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Seminar
NEW ORDER. Die Großsiedlung im Film.
Bachelor Entwurf
Was bleibt von Halle-Neustadt? Deutungskonflikte, Wertekonzepte, städtebauliche Denkmalpflege
Bachelor Thesis
Im Saaletal – Revitalisierung von Bauten im Camburger StadtkernErsatzneubau am Alten Rathaus, Euerbach (Unterfranken)Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten
Master Vorlesung
Denkmalpflege und Heritage Management
Master Seminar
Von der Bauforschung zum Entwurf. Einblicke in die Untersuchungen und denkmalpflegerischen Planungen zum Residenzschloss Weimar (in Weiterführung der Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar)
Romanische Dachwerke - ein Semester „im Holz“
Master Projekt
Erholung ohne Ende – Denkmalpflegerischer Wert und stadträumliche Effekte des Massentourismus
Master Thesis
Revitalisierung des Mainzer Hofes, Treffurt
Nach dem Brand der Viehauktionshalle – Konzepte für ein historisch vielschichtiges Areal in Weimar
Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten
Sanieren mit System
Denkmalpflegerische Zielstellung für einen verschwundenen Garten
Sommersemester 2015
Bachelor Thesis
» Im Saale-Tal – Revitalisierung von Bauten im Camburger Stadtkern
» Weiterbauen – Atelierhaus Peter Keler, Bad Berka
» Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten
Master Seminar
» Pyramiden, Pavillons und Portale – Schloss- und Museumseingänge als (Um)Bauaufgabe
» Wissenschaftliches Arbeiten
» Zollstock, Tachymeter oder Laserscanner? – Bauaufnahme
Master Projekt
» Stadt – Schloss – Portal. Ein neues Entrée für das Residenzschloss Weimar
» Denkmal Halle-Neustadt
Master Thesis
» Stadt – Schloss – Portal. Ein neues Entrée für das Residenzschloss Weimar
» Das Neue trifft auf das Alte – Studien zu Planung und Umbau von DDR-Städten
Freies Projekt
» Bauwerkstatt Schloss Bedheim
Weitere Informationen zu den einzelnen Themen erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte.
Wintersemester 2014/15
Bachelor Entwurf
» Verdrängt – Die Saalecker Werkstätten und die Kulturlandschaft Naumburg / Bad Kösen
Bachelor Thesis
» Rekonstruktion öffentlicher Räume am Beispiel der Weimarer Innenstadt
» Ersatz Neubau – Ergänzung des Schleiermacherhaus-Ensembles in Berlin
Master Seminar
» Welche Moderne? – Nachdenken über eine Epoche, ein Lebensgefühl, Architektur ...
Master Thesis
» Rekonstruktion öffentlicher Räume am Beispiel der Weimarer Innenstadt
» Das Neue trifft auf das Alte – Fallstudien zu Planung und Umbau von DDR-Städten
» Weiterbauen. Ergänzende Interventionen an der Klosterkirche Thalbürgel
Weitere Informationen zu den einzelnen Themen erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Professur Denkmalpflege und Baugeschichte.
Sommersemester 2014
Bachelor Entwurf
» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere
Bachelor Thesis
» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere
» Humboldt-Gymnasium, Weimar-West
» Planungen für das sozialistische Stadtzentrum von Erfurt
» Vorhangfassaden der DDR-Moderne
Bachelor & Master
» Bauwerkstatt Schloss Bedheim
Master Seminar
» Rekonstruktion? Zwischen Denkmalpflege und Neubau. Das Beispiel Weimar
Master Projekt
» Urlaub für alle - Zur Genese und Entwicklung sozialtouristischer Architektur
Master Thesis
» Historische Quartiere für die Zukunft - Bauen im Kontext historischer Stadtquartiere
» Planungen für das sozialistische Stadtzentrum von Erfurt
Wintersemester 2013/14
Endpräsentation Thesis WS 2013/14
Die öffentlichen Endpräsentation der am Lehrstuhl entstandenen Abschluss-Arbeiten finden am 3.2., 5.2. und 7.2.2014 jeweils im Raum 108 des Hauptgebäudes, Geschwister-Scholl-Straße 8a, statt. Die genauen Termine finden Sie in der nachfolgenden Übersicht.
| Bearbeiter | Thema | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Analyse | 08.00 – 08.30 | |
| Yang, Fan (BA) | Altenburg | 08.30 – 08.55 |
| Schulze Greve, Johann (BA) | Altenburg | 09.00 – 09.25 |
| Keogh, David (BA) | Altenburg | 09.30 – 09.55 |
| Mende, Annika (BA) | Altenburg | 10.20 – 10.25 |
Detsch, Nora (BA) | Altenburg 1 | 10.30 – 11.00 |
| Walecki, Friederike (BA) Benjamin, Katharina (BA) | Altenburg 2 | 11.15 – 11.55 |
| Bearbeiter | Thema | Zweitgutachter | Zeit |
|---|---|---|---|
| Külbel, Dorothea (MA) Schiecke, Liesa (MA) | Teichplatz/Theaterplatz1 | Prof. Stamm-Teske | 09.00-10.00 |
| Höring, Mareile (BA) | „Abgehängt?“ | 10.05 – 10.35 | |
| P a u s e | 10.35 – 11.05 | ||
| Shang, Jia (MA) | Zeughof | Prof. Rudolf | 11.05 – 11.45 |
| Heidecke, Andrea (MA) | Altes Hufeland-Klinikum, Weimar | Prof. Schönig | 11.50 – 12.30 |
| Mittagspause | 12.30 – 13.30 | ||
| Lausch, Frederike (MA) | HAB Weimar 1980er Jahre | Prof. Weizman | 13.30 – 14.15 |
| Ho, Nguyet Thu Phuong (BA) | Denkmalpflege in der Altstadt von Hanoi | 14.20 – 14.50 | |
| Hotka, Ray (MA) Slimane, Lilia Bel Hadj (MA) Bergt, Maxi (MA) | Kirchen Kyffhäuserkreis | Prof. Welch-Guerra | 16.15 - 17.45 |
| Szamborzki, Alexander (MA) | Zeughof | Prof. Gumpp | 17.50 – 18.30 |
| Bearbeiter | Thema | Zweitgutachter | Zeit |
|---|---|---|---|
| Rasch, Franziska (BA) | Denkmalpflege im ländlichen Raum | 09.25-09.55 | |
| Straube, Ulrike (MA) | Schulerweiterung | Prof. Nentwig | 10.00 – 10.40 |
| Schulze, Shabnam (MA) | Kunstblumenfabrik in Sebnitz | Prof. Nentwig | 10.45 – 11.25 |
| Ruhl, Mariana | Schloss Köstritz | Dr. Gyimothy | 11.30 – 12.10 |
Interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer sind herzlich eingeladen.
Bachelor Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Entwurf
» Abgehängt? Bahnhöfe in Thüringen
Bachelor Thesis
» Altenburg, Johannisstraße 16 bis 18.Umnutzung dreier Bürgerhäuser für Mitarbeiter des Klinikums Altenburg
Seminar Master Urbanistik
» Buchenwald als städtebauliches Denkmal? Erkundungen zwischen Stadt und Gelände
Seminar Urbanistik
» "Urban traces of violence"
Seminar Master Architektur
» Neapel in Schichten - Napoli stratificata
Master Vorlesung
» Denkmalpflege und Heritage Management
Master Projekt
» Zeughof, Weimar. Entwicklungskonzepte für ein innerstädtisches Areal im Wandel
Master Thesis
» Freies Thema
Sommersemester 2013
Bachelor Entwurf
» Industriedenkmale Erfurt - Wohnen und Arbeiten im Speicher
Bachelor Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Bachelor Exkursion
» Venedig
Seminar BA-Urbanistik
» Stadt als Denkmal
Bachelor Thesis
» Bauen im Kontext. DDR-Architektur in den Innenstädten
» Dessau - Die unkenntliche Moderne
» Ein Anbau für den Römischen Pavillon, Drackendorfer Park bei Jena
» Die Burg Hausneindorf: künftiger Mittelpunkt des Ortes. / Um- und Nachnutzungskonzepte
» Ein neuer Turm für die Kirche in Markröhlitz. Entwurf
» Das "stille Haus" nebst Scheune, Hof Nr. 21, Nermsdorf, Weimar. Um- & Nachnutzungskonzepte
» Ein Bebauungsplan für das Schießhausgelände in Weimar
» Ausgewählte DDR-Kulturhäuser & -Stadthallen der 60er und 70er Jahre. Denkmale der Ostmoderne?
Master Thesis
» Bauen im Kontext. DDR-Architektur in den Innenstädten
» Das E-Werk in Weimar Bestandsanalyse, Zielvorgaben und Entwurf für eine zukünftige Weiterentwicklung des Areals
Summerschool
» Samarkand/Usbekistan
Wintersemester 2012/13
Master Thesis
» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg
» "Neues Bach-Haus" in Weimar
» Buchenwaldplatz mit Ernst-Thälmann-Denkmal
» Entwicklung des Kloster-Quartiers Oberweimar
Master Entwurf
» Neues "Bach-Haus" Weimar
Master Vorlesung
» Denkmalpflege und Heritage Management
Bachelor Thesis
» Ausflugsgaststätte Kornhaus Dessau - Planung eines Gesamtkonzepts und Entwurf eines Kiosk
» Studentisches Wohnen im Welterbe? - Umnutzung der Laubenganghäuser der Siedlung Dessau Törten
» Unkenntliche Moderne: Umnutzungs- & Sanierungskonzept für die DEWOG-Häuser in Dessau
» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg
» "Neues Bach-Haus" in Weimar
Bachelor Entwurf
» Industriedenkmalpflege an Beispielen in Erfurt
Bachelor Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Sommersemester 2012
Bachelor Entwurf
» Konversion der Jugendstrafanstalt Ichtershausen / Thüringen – Studentischer Ideenwettbewerb
Bachelor Thesis
» Konversion der Jugendstrafanstalt Ichtershausen / Thüringen
» Mein Auto - Mein Garten - Mein Balkon
» Ein Gestaltungsleitfaden für den historischen Stadtkern Haldensleben
» Ein Konzept für die Dorfkirche Räbel (Sa.-Anh.)
» Wie füllt man 19.000m² ? - Nutzungskonzept für die KET-Halle Weimar
» Das Ornament der Nachkriegsmoderne - Beton- und Keramikformsteinwände
» Frauenfriedenskirche Frankfurt am Main
» Roland-Kaufhaus in Haldensleben: Altlast oder Potential?
» Der SED-Parteischulkomplex in Erfurt
» Ehemaliges Chausseehaus Süßenborn - Ein Haus auf verlorenem Posten?
Master Seminar
» Kopenhagen: Stadtbaukunst und Wohnungsbau der Moderne
» Magnitogorsk, erster Wohnkomplex
Master Thesis
» Wie füllt man 19.000m² ? - Nutzungskonzept für die KET-Halle Weimar
» Roland-Kaufhaus in Haldensleben: Altlast oder Potential?
» Magnitogorsk, erster Wohnkomplex
» Wettbewerb: Zugewachsen? Denkmalrelevante Spuren in Gärten und Landschaften
Wintersemester 2011/12
Bachelor Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Bachelor Thesis
» Das klassizistische Herrenhaus Rothspalk in Mecklenburg
» Ein Konzept für die Dorfkirche Räbel (Sa.-Anh.)
» Unkenntliche Moderne - Bauhistorische Untersuchung der DEWOG-Häusern in Dessau
» Umnutzung der Moderne - Ein Informationsort für die Siedlung Dessau-Törten
» Das Ornament der Nachkriegsmoderne - Beton- und Keramikformsteinwände
» Buchenwaldplatz mit Ernst Thälmann-Denkmal
» Die Gartenlaube
Master Projekt
» ROTE SPITZEN // Die Anwesenheit der Abwesenheit
Master Vorlesung
» Denkmalpflege und Heritage Management
Master Thesis / Diplom
Auf Anfrage.
Sommersemester 2011
Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Seminar
» Rom - die Antike weiterbauen
Thesis BA
» Raumbuch / denkmalpflegerische Bewertung für das Verwaltungsgebäude von Dyckerhoff Zement
» Kirche Allendorf - ein Modellprojekt zur künftigen Nutzung zu großer Kirchenräume » Buchenwaldplatz mit Ernst-Thälmann-Denkmal
» Die Dorfkirchen in den Ortsteilgemeinden der Stadt Weimar. Potentialanalyse unter dem Aspekt des Kulturlandschaftsraumes
» IGA-Architektur. Die Hochbauten auf dem Gelände der Gartenbauausstellung iga'61 in Erfurt
» Ein Entwurf für das Wohnhaus Karlsstraße 14, Weimar
» Umnutzung des ehemaligen Kammergutes Lützendorf, Am Herrenrödchen 2, 3
» Ein Konzept für das Landhaus Süßenborn, Weimar
» Ein Konzept für die ehemaligen Ackerbürgerscheunen, Coudraystraße, Weimar
Thesis MA / Diplom
» Kirche Allendorf - ein Modellprojekt zur künftigen Nutzung "zu großer" Kirchenräume
» Franco-Judaicum und Scola Oecologica, Berkach (Südthür.)
» Quartiersentwicklung am Zeughof, Weimar
Semesterprojekt
» Diversität im Denkmalbereich
Wintersemester 2010/11
Bachelor | Kernmodul
» Das Petersberg-Projekt
Interdisziplinäres Seminar
» Die Mensa in Weimar - Denkmalpflege der Moderne
Sommersemester 2010
Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 2. Teil: Von der Gotik bis zur Schwelle der Moderne
Seminar
»Denkmalpflegerische Praxis. Eine Einführung und Übung anhand von aktuellen Beispielen
Semsterprojekt Master / Diplom
» Venedig: Forte Maghera
BA Thesis
» Buchenwaldplatz mit Ernst Thälmann-Denkmal
» Weimar als sozialistische Stadt
» Haldensleben, Weiterbauen in einer Werkssiedlung der 1920er Jahre
» Nachnutzungsstudien für das "Haus zum Mohrenkopf" in Erfurt
» Kartäuser Mühle, Erfurt
» Ein Konzept für das ehemalige Franziskanerkloster Arnstadt
» "Die Entdeckung der Altstadt" seit den 1970er Jahren
Diplomthemen
» Innerstädtischer Funktionswandel - sechs Brachen im denkmalgeschützten Kontext
Wintersemester 2009/10
Vorlesung
» Architekturgeschichte I. 1. Teil: Von den Anfängen bis zur Baukunst des Mittelalters
Seminare
» Architektur und Stadt in der niederländischen Malerei
» 1000 Jahre niederländische Architektur
» Denkmalpflegerische Praxis. Eine Einführung und Übung anhand von aktuellen Beispielen
Entwurf
» Bad Langensalza
Freie Entwürfe für Master- und Diplomstudiengang
» Ein Konzept für das Landgut Holzdorf
» August Lehrmann. Stadtbaurat in Weimar 1908 - 1937
» Altstädter Schule - Celle (Architekt: Otto Haesler)
Sommersemester 2009
Vorlesung
» Stadt als Denkmal (Bachelor Urbanistik)
» Architekturgeschichte I. Teil 2
Entwurf
» Empfangsgebäude für das Kloster Memleben
Seminar
» Klassizismus - Architektur um 1800 (Bachelor)
» Fotografische Perspektiven. Neues Bauen in Erfurt (Bachelor)
» Paris in der bildenden Kunst (Master)
» Bauforschung (Master)
» Studentenworkshop in Karlskrona (Bachelor)
Diplom
» Kloster Memleben
Bachelor/Thesis
» Ausstellungskonzeption - Neues Bauen in Erfurt
» Der Innere Neustädter Friedhof in Dresden
» Das Wohnhaus Andreasstraße in Erfurt - Dokumentation und Schadenskartierung
» Die nördliche Marktplatzbebauung in Weimar
» Das Schillermuseum (1984-88) als Anbau an das historische "Schillerhaus"
» Der "Lange Jakob" als Zeugnis der sozialistischen Stadtplanung
» Das Ornament in der zeitgenössischen Architektur
Wintersemester 2008/09
Vorlesung
» Architekturgeschichte I (Bachelor)
» Ringvorlesung - Denkmalpflege (Bachelor)
» StadtArchitektur - Ringvorlesung - Par Example Paris (Master)
Entwurf
» Klosterruine Arendsee
» Krapivna
Seminar
» Denkmalpflege der Moderne. Der Eiermann-Bau in Apolda
» Die Dynamik des Bestands. Zur Baugeschichte und städtebaulichen Denkmalpflege von Paris
Übung
» Paris im Film
Diplom
» Alte Mühle Grimma
» Straßenbahndepot Erfurt
» Schloß Übigau, Dresden
» Altes Seminar in Grimma
» Engelplatz Jena
» Gefängnis in Halle
» Finsterwalde, Markt
» Lichtspieltheater Zwickau