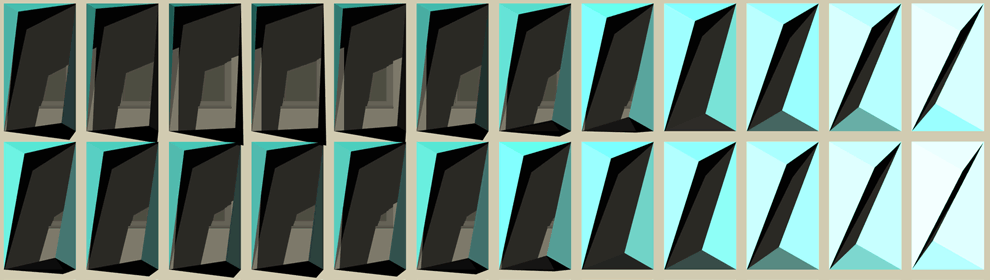
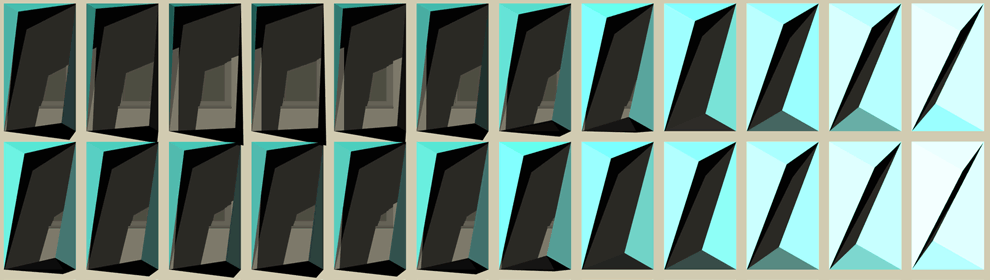
Abschlussarbeiten
Nachfolgend sind Themenschwerpunkte zu finden, die wiederum konkretere Themenvorschläge für Studien-, Bachelor-, Masterarbeiten oder freie Entwürfe enthalten. Bei Interesse kann die entsprechende Ansprechperson kontaktiert werden.
Bauen mit Stroh
Im Rahmen des Forschungsprojekts »StrohGold« wird ein neuer lasttragender Wandbaustoff auf der Basis von Stroh entwickelt. Um umfassende Aussagen über seine Eigenschaften treffen zu können, sind entsprechende teils theoretische teils praktisch experimentelle Untersuchungen notwendig.
Hintergrund: Durch zunehmende Rohstoffverknappung, Preiserhöhung von Baustoffen und nicht zuletzt die Klimakrise ist es naheliegend, nach günstigen regional verfügbaren und erneuerbaren Ressourcen zu suchen. Dadurch können auch die Zerstörung von natürlichen Lebensräumen für den Rohstoffabbau und internationale Abhängigkeiten vermindert werden. In diesem Zuge soll Stroh als Baustoff auf sein Potential hin untersucht werden.
Folgende Themen können jeweils als eine Studien- oder Abschlussarbeit an die Forschungsarbeiten angedockt werden.
1. Schalldämmendes Potenzial
Die schalldämmenden Eigenschaften des neuen Baustoffs sollen experimentell untersucht werden. Dafür ist ein geeigneter Versuchsaufbau zu entwickeln und mit Messapparaturen durchzuführen. Mit den gewonnen Erkenntnissen sollen anschließend Schallschutzmaßnahmen für verschiedene Szenarien vorgeschlagen werden, wenn diese erforderlich sein sollten.
2. Wärmedämmendes Potenzial
Die wärmedämmenden Eigenschaften des neuen Baustoffs sollen experimentell untersucht werden. Dafür ist ein geeigneter Versuchsaufbau zu entwickeln und mit Messapparaturen durchzuführen. Ziel dieser Untersuchung ist es, den ungefähren U-Wert und die Wärmespeicherkapazität des Strohbaustoffs zu bestimmen.
3. Ökobilanzielles Potenzial
Untersucht werden soll die Frage, wie stark der Einsatz des neuen Strohbaustoffs den Verbrauch von nicht erneuerbarer Energie und den Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen verringern kann. Neben dem ökobilanziellen Vergleich von Referenzgebäuden verschiedener Bauweisen kann auch eine Sensitivitätsanalyse zur Einflussermittlung möglicher Zuschlagstoffe im Strohbauteil durchgeführt werden. (Wenn gewünscht, kann eine Einführung mit Grundlagenwissen bzgl. der Ökobilanzierung gegeben werden.)
4. Konkurrenzfähigkeit
Um herauszustellen, welche Stellschrauben zur Förderung des Baustoffs Stroh beitragen können, sollen Kriterien festgelegt werden, an denen die Konkurrenz- bzw. Marktfähigkeit ermittelt und bewertet werden kann. Da die ökonomische Komponente eine wichtige Stellschraube darstellt, soll zusätzlich das ökonomische Potential im Vergleich zu anderen Bauweisen rechnerisch eingeschätzt werden.
Ansprechperson: Katharina Elert → Anfrage per E-Mail
Bauen mit Lehm
1. Oberflächenveredelung
Im Zuge der Arbeit werden Techniken der Oberflächenveredelung entwickelt und erprobt. Dabei bildet eine Recherche zu aktuellen Lehmveredelungstechniken die Grundlage der Arbeit. Praktische Versuche untermauern die Aussagen. Das Thema steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Forschung zur Lehmtafelbauweise.
2. Recycling
Im Zuge der Arbeit werden Recyclingtechniken im Lehmbau entwickelt und erprobt. Neben einer Recherche zu aktuellen Recyclingverfahren im Lehmbau, soll anhand labortechnischer Versuche ein Leitfaden erstellt werden. Das Thema steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Forschung zur Lehmtafelbauweise.
3. Akzeptanz von Lehmbau
Im Zuge der Arbeit soll die Akzeptanz von Lehmbau untersucht werden. Durch eine Umfrage soll das aktuelle Stimmungsbild der Bevölkerung zum Lehmbau abgefragt werden. Anschließend sollen die Ergebnisse der Umfrage verständlich aufbereitet und ausgewertet werden. Hat das moderne Bauen mit Lehm eine Chance auf dem deutschen Markt? Das Thema steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Forschung zur Lehmtafelbauweise.
4. Transport und Einbau
Im Zuge der Arbeit sollen Transporttechniken und Einbaustrategien von Lehmfertigteilen untersucht und erprobt werden. Dabei bildet eine Recherche im Bereich Fertigteilbau die Grundlage der Arbeit. Anhand von Analogiemodellen sollen Empfehlungen für Transport und Einbau gegeben werden. Das Thema steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Forschung zur Lehmtafelbauweise.
Ansprechperson: Larissa Daube → Anfrage per E-Mail
Digital Fabrizieren
1. AI dreams Architecture
In den letzten Jahren hat das maschinelle Lernen rasante Fortschritte gemacht. Im Zuge dessen sind Programme entstanden, die aus Textbeschreibungen realistische Bilder in jedweder Form generieren können. Die Ergebnisse sind so beeindruckend, dass sie auch in der Architekturpraxis einen wichtigen Platz einnehmen könnten. Als Untersuchungsgegenstand sollen Programme wie Dall-E getestet werden. Dabei gilt es herauszufinden, inwieweit diese Programme den Entwurfsprozess in der Architektur bereichern könnten.
2. 3-D Scanning (Photogrammetry) and its capabilities in using recycling materials in a digital planning process
Die Wiederverwendung vorhandener Baumaterialien wird immer wichtiger. Wie können wir moderne 3-D-Scan-Technologien, die sogar in unseren Smartphones Einzug gehalten haben, nutzen, um alte Materialien zu kategorisieren und in einen digitalen Entwurfs- und Planungsprozess einzubinden.
Ansprechperson: Lukas Kirschnick → Anfrage per E-Mail
Ökonomische Nachhaltigkeit
Im Zuge der Arbeit soll das Themenfeld der ökonomischen Nachhaltigkeit genauer untersucht werden. Neben einer Einführung in das Gebiet sollen Parameter zur Bemessung der ökonomischen Nachhaltigkeit ermittelt werden. Die Betrachtung von unterschiedlichen Bauweisen soll schließlich eine Bewertung der ökonomischen Nachhaltigkeit zulassen. Die Bewertung soll hohen gestalterischen und wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden.
Ansprechperson: Katharina Elert → Anfrage per E-Mail
Soziale Nachhaltigkeit
1. Soziale NachhaltigkeitIm Zuge der Arbeit soll das Themenfeld der sozialen Nachhaltigkeit genauer untersucht werden. Neben einer Einführung in das Gebiet sollen Parameter zur Bemessung der sozialen Nachhaltigkeit ermittelt werden. Die Betrachtung von unterschiedlichen Bauweisen soll schließlich zu einer fundierten Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit führen. Die Bewertung soll hohen gestalterischen und wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden.
Ansprechperson: Larissa Daube → Anfrage per E-Mail
Weitere Themen
· Hitze in der Stadt
· Puffern und Kompensieren von extremen Wetterereignissen
· Suffizienz – die unbequeme Strategie nachhaltig zu werden
· Advanced LowTech
· Rezyklierbare Bauweisen
· Wandelbare Konstruktionen
· Ökobilanzierung
· Nachverdichten im urbanen Kontext
· Türme, Masten, Schalen, Membranen, Tensegrity
Ansprechperson: Katrin Linne → Anfrage per E-Mail
