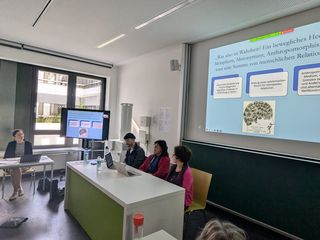Vergangene Veranstaltungen:
1. Arbeitstreffen 15., 16. Mai 2025, Uni Bielefeld
Anthropomorphisierung? Erzählen und der Mensch
Organisation: Charlotte Coch, Lore Knapp, Ronald Röttel
Das erste Arbeitstreffen fand als Lektüre-Workshop zum Kontext und Begriff der Anthropomorphisierung statt. Dieser schien ein geeigneter Kandidat für eine praxeologische Rekonzeptualisierung der für das Netzwerk maßgeblichen Aktivität des Erzählens und den besonderen Herausforderungen, denen sich ein mehr-als-menschliches Erzählen gegenüber sieht. In den Debatten um das humanistische aber auch posthumanistische Potenzial erzählerischer Strategien wird Anthropomorphisierung immer wieder als ethisch und praktisch herausfordernde, aber unhintergehbare Grundbedingung der Annäherung an Nichtmenschliches gerahmt. Um diesem Verhältnis differenziert auf die Spur zu kommen, wurden epistemische und ästhetische anthropomorphisierende Praktiken und der Diskurs über diese aus verschiedenen disziplinären Blickwinkeln theoretisiert. In der Betrachtung des Verhältnisses von Erzählen als grundlegender kultureller Aktivität und ‘Vermenschlichung’ ging es insbesondere darum, nicht nur die Gefahren und/oder Chancen eines anthropomorphisierenden Erzählens (vgl. etwa Herman 2019) herauszustellen, sondern vielmehr herauszuarbeiten, inwiefern Konzepte des Anthropomorphismus und des Anthropomorphisierens im Erzählen die Vorstellung des Menschen selbst in etwas Prozessuales, eben post-humanistisches transformieren können.
Um die fachlichen Perspektiven der Netzwerkmitglieder, die aus ethnologischen, nationalphilologischen, komparatistischen und medienwissenschaftlichen Interessen auf den Begriff blicken, mit anderen Blickwinkeln zu kontrastieren, wurden Gäste aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen eingeladen, die sich mit Anthropomorphisierung als epistemischer Herausforderung beschäftigen. Diskussionsgrundlage war ein gemeinsamer Reader mit zentralen Texten zur Anthropomorphisierung aus den jeweiligen Disziplinen.
Prof. Ute Knierim von der Universität Kassel berichtete als Nutztier-Ethologin über den Umgang mit und den Diskussionsstand zu Anthropomorphisierung in der Verhaltensforschung zu Tier-Mensch-Interaktionen. Knierim thematisierte insbesondere anthropomorphisierende Zugänge zur Frage der Affektivität von Tieren und plädierte für einen kritischen Anthropomorphismus, der die epistemischen Grenzen von Analogiebildungen anerkennt, das hierin liegende Potenzial von interspezieller Empathie aber zu nutzen weiß.
Prof. Linda Onnasch von der TU Berlin berichtete als Psychologin und Forscherin im Bereich der Human-Robot-Interaction über den Diskussionsstand zu Anthropomorphisierung in der HRI-Forschung. Sie unterschied drei Bedeutungsdimensionen des Begriffs als Wahrnehmungs- und Attributionsprozess, d.h. als einen Mechanismus zur Erleichterung der Interpretation von Verhalten und zur Unsicherheitsreduktion, als Persönlichkeitsmerkmal, insofern die Neigung zum Anthropomorphisieren im Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann und als Designinstrument, das die Mensch-Roboter-Interaktion erleichtern aber auch erschweren kann, insbesondere dann, denn es sich um rein dekoratives anthropomorphisierendes Design handelt.
Manuela Marquardt von der Charité Berlin und Philipp Graf von der Hochschule München berichteten als Soziolog:innen aus dem Bereich der Medizinsoziologie von den disparaten Zugängen zur Anthropomorphisierung aus sozial-, gesellschafts- und wissenssoziologischer Sicht. Sie diskutierten verschiedene Ansätze, wie Anthropomorphisierung als soziale Praxis funktional analysiert wird bzw. welche konkurrierenden Begriffe es gibt (z.B. Soziomorphisierung) und warfen darüber hinaus die Frage auf, dass es ebenfalls gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterliegt, welche Zuschreibungen überhaupt als Anthropomorphisierungen gewertet werden.
Prof. Grazia Pulvirenti und Prof. Renata Gambino von der Universität Catania berichteten als Narratologinnen vom Diskussionsstand zu Anthropomorphisierung in der kognitionswissenschaftlichen Erzähltheorie. Sie rekapitulierten die Frage der Möglichkeit eines Erzählens von anderen Erfahrungswelten (etwa tierischen) im Bereich der Human-Animal-Studies und der Erzählforschung und betonten die Fruchtbarkeit eines kognitionswissenschaftlichen Ansatzes, der auf die verkörperte Qualität von erzählerisch vermittelten Erfahrungen setzt und damit den Vorgang des Lesens oder Rezipierens von Narrativen als selbst körperliche Erfahrung begreifen kann, über deren Vermittlung dann auch die erzählten Erfahrungen zugänglich werden.
Prof. Daniel Illger von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) berichtete zum Begriff der Anthropomorphisierung in den Game Studies. Am Beispiel des Games CyberPunk 2077 führte er den Zusammenhang zwischen anthropomorphisierenden und dehumanisierenden Strategien vor, welche er als zwei Seiten einer Medaille begreift. Das Videospiel führt dies, wie Illger an Beispielsequenzen zeigte, vor, insofern sich die mediale Umgebung durch Glitches, Störungen und Möglichkeiten des enhancements in Subjektentwürfe und spezifische durch die narrative Logik des Spiels erlebbare Körpererfahrungen einschreibt, die damit in diesem Spannungsfeld zu verorten sind.
Die Diskussionen zeigten die Vielfalt und Bandbreite des Konzepts von Anthropomorphisierung. Einerseits ist damit eine Komplexität reduzierende Praxis im sozialen Gefüge bezeichnet, die eine Kontaktzone zwischen Menschlichem und Nichtmenschlichem modelliert und damit die Grenze zwischen Menschen und Nichtmenschen betont wie irritiert. Anthropomorphisierendes Beschreiben von nichtmenschlichen Gegenübern ist so einerseits Grundlage für epistemisches, ästhetisches und emotionales Annähern und Einfühlen wie auch ein Hindernis dafür.
Gleichzeitig hat die Diskussion auch gezeigt, dass ‘Anthropomorphismus’ als Kategorie und Zuschreibung selbst spezifische Funktionen erfüllt und diskursive Grenzen errichtet. Dieses Wechselspiel aus Gestaltung der sozialen Realität und diskursivem Sprechen über die Gestaltung sozialer Realität gilt es in den Debatten um das Für und Wider von anthropomorphisierendem Erzählen stärker zu berücksichtigen.
Anstehende Veranstaltungen:
2. Arbeitstreffen: 23.-24. Oktober 2025, ZfL Berlin
Künstlerisch-wissenschaftlicher Workshop: Exploration posthumanistischer Erzählpraxis: Verteilen, Skalieren und Perspektivieren
Organisation: Eva Axer Charlotte Coch, Daniela Doutch, Philipp Ohnesorge, Simon Probst, Ronald Röttel, Philipp Weber
Der künstlerisch-wissenschaftlicher Workshop nähert sich der Frage nach Praktiken des posthumanistischen Erzählens in Text, Bild, Performances und anderen Erzählmedien aus der Perspektive der teilnehmenden Beobachtung. In interaktiven Performances werden konkrete Problemstellungen identifiziert, die sich in der Auseinandersetzung mit neuen Objekten des Erzählens und neuen Erzählweisen stellen; Ziel ist es, von den Künstler:innen zu lernen. Erzählen wird nicht aus der Perspektive des fertigen Werks, sondern vielmehr aus der prozessualen Perspektive des Erzählens selbst, seinen inhärenten Beziehungsangeboten und der zeitlich wie räumlich kontextualisierten Performanz betrachtet. Die Veranstaltung ist als Folge von drei aneinander anschließenden, jeweils zweistündigen Workshops geplant, die aus drei praktischen Perspektiven (Verteilen, Skalieren, Perspektivieren) Prozesse eines storytellings im Austausch mit der mehr-als-menschlichen Welt praktisch erfahrbar machen. Die Ergebnisse der Workshoparbeit werden in ihren diversen Dokumentationsformaten im Sommer 2027 auch Bestandteil der geplanten Ausstellung sein.
Podiumsdiskussion / Panel Discussion am 23.10.2025, 19-20.30, ZfL Berlin
mit: Jenifer Becker, Nonhuman Nonsense, Nina Nowak, I.V. Nuss, Gonzalo Rodriguez
Moderation: Charlotte Coch, Simon Probst
Nonhuman Narration in Arts & Literature: Tales of Chatbots, Stones and Cells
Is it possible to tell stories with and for nonhuman entities? This panel brings together authors and artists who attempt to do just that, hereby exploring the limits of narrative and representation. How do the artists attempt to do justice to the plural logics of nonhuman entities in their work? We will talk about specific art works, projects and installations to shed light on a new ethos of collaboration and the way it affects artistic work and the human perception.
Questions to be asked include the following: Are large language models truly capable of generating stories on their own, or do they simply draw upon human imagination? What would it mean for human storytellers to collaborate with a mosquito or to speak on behalf of a glacier? How can we grasp nonhuman scales that surpass human imagination and how can mediation between different scales be made tangible, both materially and physically? What stories do obsolete technological objects tell about themselves—and about us? And to what extent do fusions between humans and machines, glitches between biological and virtual personalities, and deliberate mergings between humans and animals generate new narratives about life on this planet?
3. Arbeitstreffen: 07.-09. Mai, Weimar
Erzählte und erzählende Umwelten
(Vorläufiges) Orga-Team: Charlotte Coch, Matthias Grüne, Oliwia Murawska, Ronald Röttel, Ruxandra Teodorescu
Im Zentrum des dritten Arbeitstreffens wird ein tragfähiger Begriff von Umwelten des Erzählens entwickelt, welcher die Konjunktur des Ökologie-Konzepts in multidisziplinären Kontexten (Medienökologie, Neo-Ökologie etc.) für die Erzähltheorie im engeren Sinne fruchtbar macht. Jenseits einer Aufteilung in environmental humanities und digital humanities wird die Umwelt des Erzählens als wechselseitige Verwobenheit von Natur und Technik perspektiviert. Grundlage ist zunächst eine historisierende Betrachtung von Umweltkonzeptionen und ihren Konjunkturen in gesellschaftlichen Debatten und ästhetischen Verortungen, sowie dann die Frage nach Umweltentwürfen und Umweltverhandlungen in Formaten und Praktiken des Erzählens selbst.
4. Arbeitstreffen: Basel, 17.-18.09.2026
Didaktischer Praxisworkshop: Posthumanistisch erzählen und bilden
(Vorläufiges) Orga-Team: Charlotte Coch, Andreas Hudelist, Verena Kuni, Simon Probst, Anne-Kathrin Reulecke, Ronald Röttel, Ruxandra Teodorescu
Die ‘Bildung’ des Menschen durch äußere und innere Formung gehört zu den zentralen Pfeilern des Humanismus und wirkt institutionell und kulturell bis in die heutige Zeit. Formen und Gattungstraditionen des Erzählens kommt dabei (Stichwort Bildungsroman) eine wesentliche Rolle zu. Fokussiert wird dabei in der Regel auf den Menschen, sein Innenleben und seine sozialen Beziehungen. Wie lassen sich diese mit tradierten Bildungsidealen verbundenen Prämissen angesichts gegenwärtiger Herausforderungen durch technische Entwicklung und damit verbundene ökologische Gefährdung rekonfigurieren? Der Workshop fragt nach zwei Dimensionen posthumanistischer Bildung mit und durch Geschichten. Auf der Ebene der Bildungsinhalte steht die Frage im Zentrum, wie die Beziehung von Menschen zur mehr-als-menschlichen Welt (Pflanzen, Tiere und Klima sowie Medien und Maschinen) erzählend gelernt und gelehrt werden kann. Auf der Ebene einer technisch-medialen Veränderung von Bildungsprozessen fragt der Workshop danach, wie die Praktiken des Lernens mit Geschichten sich in Medienökologien verändern, in denen digitale Technologien und künstliche Intelligenzen eine zunehmend wichtige Rolle spielen.
5. Arbeitstreffen: Ausstellungseröffnung / Exhibition Opening: 27. Oktober 2027, Volkswagen-Universitätsbibliothek der TU und UdK Berlin
PRANA: Posthuman Research and Narration
Vorläufiges Orga-Team: Eva Axer, Charlotte Coch, Daniela Doutch, Stefanie Heine, Verena Kuni, Oliwia Murawska