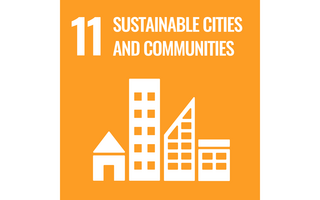
Städte und Gemeinden inklusiv, sicher, belastbar und nachhaltig machen.
SDG 11 besteht daraus, Städte und andere Siedlungen so zu erneuern und zu gestalten, dass sie mit einem Zugang zu grundlegenden Diensten, Energie, Wohnraum, Transportmitteln und öffentlichen Grünflächen allen Menschen Chancen bieten und gleichzeitig den Ressourcenverbrauch verbessern und die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
SDG 11 fordert den Schutz des Weltkultur- und -naturerbes und die Unterstützung positiver wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und ländlichen Gebieten. Es steht ebenfalls für eine verbesserte internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder in Bezug auf die Errichtung nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude.
Bauingenieurwesen (B. Sc.)
Baukonstruktion
In diesem Modul werden Kenntnisse zu Klimaanpassung und Ressourceneffzienz, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, Energieeffizienz sowie Nachhatligem Bauen vermittelt. Durch diese Schwerpunkte wird das Verständnis der Studierenden für die Entwicklung klimaangepasster Gebäude gefördert, aber auch die Errichtung energieeffizenter Gebäude nähergebracht.
Zudem erfahren die Studierenden durch das semesterbegleitende Herstellen eines Gebäudeteilmodells im Maßstab 1:20 in Gruppenarbeit, wie ein sicheres und belastbares Gebäude im Sinne des Klimaschutzes gebaut werden sollte. Am Ende des Moduls verfügen die Studierenden über die Fähigkeit, Konstruktionsprinzipien und -lösungen aus den komplexen Zusammenhängen von Umwelt, Technologie, Konstrukion und Gestaltung zu entwickeln.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 4 ECTS-Punkte
Physik / Bauphysik
Bauphysikalische Aspekte tragen im wesentlichen zur Schaffung von energieeffizienten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden bei. Die Studierenden lernen die Grundbegriffe der thermischen, hygrischen und akustischen Bauphysik kennen. Die Sicherstellung von langlebigen und nachhaltigen Bauwerken durch bspw. Feuchtekontrollen trägt dazu bei, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Zudem sorgt eine gute Gebäude- und Stadtakustik für eine hohe Lebensqualität und unterstützt nachhaltige Siedlungsplanung.
Die vermittelten Kenntnisse befähigen die Studierenden einfache bauphysikalische Probleme zu analysieren und eigenständig zu lösen.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Mobilität & Verkehr
In der Lehrveranstaltung erlernen die Studierenden die Eignung und Bewertung verschiedener Verkehrsmittel im Kontext integrierter Konzepte zu beurteilen und dadurch nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln und zu fördern. Ein vertieftes Verständnis der Potentiale von Verkehrskonzepten für Umwelt, Klima und Wirtschaft ermöglicht es ihnen, die negativen Auswirkungen des städtischen Verkehrs auf die Umwelt zu minimieren.
Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge zwischen individueller Mobilität und dem daraus resultierenden Verkehr und können durch das Gelernte auf die Reduzierung des Verkehrsstaus, die Verbesserung der Luftqualität sowie auf die Förderung einer nachhaltigen städtischen Entwicklung einwirken.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.)
→ Pflichtmodul für Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
→ Wahlpflichtmodul "Infrastruktur" für Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (B. Sc.)
→ 3 ECTS-Punkte
Baustoffkunde - Eigenschaften von Bau- und Werkstoffen
Die vermittelten Inhalte zu Materialien im Bau- und Umweltingenieurwesen legen den Grundstein für das Verständnis von Herstellung, Eigenschaften, Anwendung und Prüfung. Sie bilden den späteren Ausgangspunkt für die Entwicklung innovativer Baustoffe und die Erneuerung sowie Instandhaltung von Infrastrukturen.
Das Verständnis für die Zusammenhänge innerer Strukturen der Materialien und ihren Eigenschaften unterstützt die Studierenden dabei, nachhaltige Lösungen für baustoffliche Probleme zu erarbeiten. Außerdem fördert die thematische Behandlung von Aufbereitung und Recycling von Baustoffen das Verständnis von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, welches nicht nur nachhaltige Stadtentwicklung, sondern auch eine umweltfreundliche Wohn- und Arbeitsumgebung fördert.
Durch praktische Übungen zu Baustoffprüfungen wird den Studierenden vermittelt, wie die Umweltauswirkungen verschiedener Materialien zu bewerten sind. Zudem können die Studierenden die Langlebigkeit von Baustoffen bewerten, was für die Entwicklung von nachhaltigen Städten und Gemeinden essentiell ist.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.)
→ Pflichtmodul für Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
→ 4 ECTS-Punkte
Ressourcen und Recycling
Durch die Veranstaltung verstehen die Teilnehmenden, wie sie durch mechanische Verfahrenstechnik und Recycling von Baustoffen zur Schaffung nachhaltiger urbaner Umgebungen beitragen können. Das gezielte Identifizieren und Nutzen von Holzarten sowie das Bestimmen wichtiger Gesteine für den Einsatz im Bauwesen ermöglichen es ihnen, Bauprojekte zu entwickeln, die lokale Ressourcen effizient nutzen und die Abfallproduktion minimieren. Sie beschäftigen sich mit den Grundprozessen der mechanischen Verfahrenstechnik wie Zerkleinern, Klassieren, Sortieren und der Charakterisierung von Schüttgütern, was ihnen die Kenntnisse verleiht, in ihren Projekten nachhaltige Materialkreisläufe zu implementieren.
Dieses Wissen trägt direkt zur Entwicklung von Infrastrukturen bei, die umweltschonend sind, die Lebensqualität urbaner Räume erhöhen und die Resilienz von Städten und Gemeinden gegenüber Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit stärken. Durch praktische Übungen und Belegarbeiten vertiefen die Studierenden ihre Fachkenntnisse in der nachhaltigen Materialverwendung und -verwaltung.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.) Vertiefung Baustoffe und Sanierung
→ 6 ECTS-Punkte
Bauwerkssanierung
In der Lehrveranstaltung erlernen die Studierenden die Analyse von Bauzuständen und Bauschäden sowie die Anwendung organisatorischer und bauplanungsrechtlicher Aspekte bei Sanierungsprojekten. Solche Kenntnisse sind entscheidend für die Renovierung und Instandhaltung urbaner Strukturen, wobei historische Baukonstruktionen und Mauerwerksinstandsetzung im Fokus stehen. Die Veranstaltung vermittelt Grundlagen der Bauwerkssanierung sowie fotogrammetrische Techniken zur Bestandsaufnahme, die eine präzise Erhaltungsstrategie und den Schutz von Baukulturerbe ermöglichen.
Studierende wenden erworbenes Wissen in einer semesterbegleitenden Belegarbeit an, um nachhaltige Sanierungsmethoden und ressourcenschonende Praktiken fördern zu können. Diese Herangehensweise trägt zur Entwicklung resilienter, lebenswert gestalteter Städte bei, indem bestehende Bauten erhalten und angepasst werden, um den Bedürfnissen der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gerecht zu werden.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.) Vertiefung Baustoffe und Sanierung
→ 6 ECTS-Punkte
Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (B. Sc.)
Baukonstruktion
In diesem Modul werden Kenntnisse zu Klimaanpassung und Ressourceneffzienz, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, Energieeffizienz sowie Nachhatligem Bauen vermittelt. Durch diese Schwerpunkte wird das Verständnis der Studierenden für die Entwicklung klimaangepasster Gebäude gefördert, aber auch die Errichtung energieeffizenter Gebäude nähergebracht.
Zudem erfahren die Studierenden durch das semesterbegleitende Herstellen eines Gebäudeteilmodells im Maßstab 1:20 in Gruppenarbeit, wie ein sicheres und belastbares Gebäude im Sinne des Klimaschutzes gebaut werden sollte. Am Ende des Moduls verfügen die Studierenden über die Fähigkeit, Konstruktionsprinzipien und -lösungen aus den komplexen Zusammenhängen von Umwelt, Technologie, Konstrukion und Gestaltung zu entwickeln.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 4 ECTS-Punkte
Physik / Bauphysik
Bauphysikalische Aspekte tragen im wesentlichen zur Schaffung von energieeffizienten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden bei. Die Studierenden lernen die Grundbegriffe der thermischen, hygrischen und akustischen Bauphysik kennen. Die Sicherstellung von langlebigen und nachhaltigen Bauwerken durch bspw. Feuchtekontrollen trägt dazu bei, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Zudem sorgt eine gute Gebäude- und Stadtakustik für eine hohe Lebensqualität und unterstützt nachhaltige Siedlungsplanung.
Die vermittelten Kenntnisse befähigen die Studierenden einfache bauphysikalische Probleme zu analysieren und eigenständig zu lösen.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Mobilität & Verkehr
In der Lehrveranstaltung erlernen die Studierenden die Eignung und Bewertung verschiedener Verkehrsmittel im Kontext integrierter Konzepte zu beurteilen und dadurch nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln und zu fördern. Ein vertieftes Verständnis der Potentiale von Verkehrskonzepten für Umwelt, Klima und Wirtschaft ermöglicht es ihnen, die negativen Auswirkungen des städtischen Verkehrs auf die Umwelt zu minimieren.
Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge zwischen individueller Mobilität und dem daraus resultierenden Verkehr und können durch das Gelernte auf die Reduzierung des Verkehrsstaus, die Verbesserung der Luftqualität sowie auf die Förderung einer nachhaltigen städtischen Entwicklung einwirken.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.)
→ Pflichtmodul für Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
→ Wahlpflichtmodul "Infrastruktur" für Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (B. Sc.)
→ 3 ECTS-Punkte
Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
Baukonstruktion
In diesem Modul werden Kenntnisse zu Klimaanpassung und Ressourceneffzienz, Sicherheit und Widerstandsfähigkeit, Energieeffizienz sowie Nachhatligem Bauen vermittelt. Durch diese Schwerpunkte wird das Verständnis der Studierenden für die Entwicklung klimaangepasster Gebäude gefördert, aber auch die Errichtung energieeffizenter Gebäude nähergebracht.
Zudem erfahren die Studierenden durch das semesterbegleitende Herstellen eines Gebäudeteilmodells im Maßstab 1:20 in Gruppenarbeit, wie ein sicheres und belastbares Gebäude im Sinne des Klimaschutzes gebaut werden sollte. Am Ende des Moduls verfügen die Studierenden über die Fähigkeit, Konstruktionsprinzipien und -lösungen aus den komplexen Zusammenhängen von Umwelt, Technologie, Konstrukion und Gestaltung zu entwickeln.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 4 ECTS-Punkte
Physik / Bauphysik
Bauphysikalische Aspekte tragen im wesentlichen zur Schaffung von energieeffizienten, gesunden und nachhaltigen Gebäuden bei. Die Studierenden lernen die Grundbegriffe der thermischen, hygrischen und akustischen Bauphysik kennen. Die Sicherstellung von langlebigen und nachhaltigen Bauwerken durch bspw. Feuchtekontrollen trägt dazu bei, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu gewährleisten. Zudem sorgt eine gute Gebäude- und Stadtakustik für eine hohe Lebensqualität und unterstützt nachhaltige Siedlungsplanung.
Die vermittelten Kenntnisse befähigen die Studierenden einfache bauphysikalische Probleme zu analysieren und eigenständig zu lösen.
→ Pflichtmodul für alle Bachelorstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Mobilität & Verkehr
In der Lehrveranstaltung erlernen die Studierenden die Eignung und Bewertung verschiedener Verkehrsmittel im Kontext integrierter Konzepte zu beurteilen und dadurch nachhaltige Mobilitätslösungen zu entwickeln und zu fördern. Ein vertieftes Verständnis der Potentiale von Verkehrskonzepten für Umwelt, Klima und Wirtschaft ermöglicht es ihnen, die negativen Auswirkungen des städtischen Verkehrs auf die Umwelt zu minimieren.
Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge zwischen individueller Mobilität und dem daraus resultierenden Verkehr und können durch das Gelernte auf die Reduzierung des Verkehrsstaus, die Verbesserung der Luftqualität sowie auf die Förderung einer nachhaltigen städtischen Entwicklung einwirken.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.)
→ Pflichtmodul für Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
→ Wahlpflichtmodul "Infrastruktur" für Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (B. Sc.)
→ 3 ECTS-Punkte
Baustoffkunde - Eigenschaften von Bau- und Werkstoffen
Die vermittelten Inhalte zu Materialien im Bau- und Umweltingenieurwesen legen den Grundstein für das Verständnis von Herstellung, Eigenschaften, Anwendung und Prüfung. Sie bilden den späteren Ausgangspunkt für die Entwicklung innovativer Baustoffe und die Erneuerung sowie Instandhaltung von Infrastrukturen.
Das Verständnis für die Zusammenhänge innerer Strukturen der Materialien und ihren Eigenschaften unterstützt die Studierenden dabei, nachhaltige Lösungen für baustoffliche Probleme zu erarbeiten. Außerdem fördert die thematische Behandlung von Aufbereitung und Recycling von Baustoffen das Verständnis von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz, welches nicht nur nachhaltige Stadtentwicklung, sondern auch eine umweltfreundliche Wohn- und Arbeitsumgebung fördert.
Durch praktische Übungen zu Baustoffprüfungen wird den Studierenden vermittelt, wie die Umweltauswirkungen verschiedener Materialien zu bewerten sind. Zudem können die Studierenden die Langlebigkeit von Baustoffen bewerten, was für die Entwicklung von nachhaltigen Städten und Gemeinden essentiell ist.
→ Pflichtmodul für Bauingenieurwesen (B. Sc.)
→ Pflichtmodul für Umweltingenieurwissenschaften (B. Sc.)
→ 4 ECTS-Punkte
Bauingenieurwesen - Konstruktiver Ingenieurbau (M. Sc.)
Der konstruktive Ingenieurbau trägt durch Verbesserung der Infrastruktur zum SDG 11 bei, indem nachhaltige Verkehrssysteme und ressourcenschonende Städte geplant werden. Intelligente Verkehrssysteme und nachhaltige Mobilitätslösungen verbessern dabei die Lebensqualität in städtischen Gebieten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Widerstandsfähigkeit von Infrastrukturen gegenüber extremen Wetterbedingungen und Naturkatastrophen. Konstruktive Ingenieur*innen entwickeln Tragwerke, die extremen Naturereignissen standhalten. Dies erhöht die Sicherheit der städtischen Bevölkerung und minimiert die Schäden, die durch solche Ereignisse verursacht werden können.
Im Studiengang Bauingenieurwesen – Konstruktiver Ingenieurbau wird das SDG 11 nicht direkt aufgegriffen. Berührungspunkte des konstruktiven Ingenieurbaus können jedoch in Studien- und Abschlussarbeiten aufgegriffen werden.
Eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem SDG 11 kann weiterhin über den Fächerkanon des Studiengangs Umweltingenieurwissenschaften (M. Sc.) dem Wahlbereich des eigenen Curriculums hinzugefügt werden.
Der Themenschwerpunkt des Schutzes vor Naturkatastrophen und extremen Wetterlagen wird im Studiengang Bauingenieurwesen – Konstruktiver Ingenieurbau (M.Sc.) nicht explizit aufgegriffen, kann aber über den Fächerkanon des Studiengangs Natural Hazards and Risks in Structural Engineering (M.Sc.) dem Wahlbereich des eigenen Curriculums hinzugefügt werden.
Baustoffingenieurwissenschaft (M. Sc.)
Projekt Bauschadensanalyse und Sanierung
Durch gezielte Sanierungsmaßnahmen können Gebäude effizient instand gehalten werden, was den Bedarf an Neubauten reduziert und die Lebensdauer bestehender Strukturen verlängert. Dies spart nicht nur Ressourcen und Energie, sondern vermindert auch Abfall und Emissionen. Eine proaktive Bauschadensanalyse und Sanierung tragen somit wesentlich zur Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden bei.
Im Rahmen des Projektes nehmen die Studierenden an einem realen Instandsetzungsobjekt eine Schadenskartierung vor. Basierend auf einer eigenverantwortlichen Konzipierung der Probennahme und der grundlegenden experimentellen Untersuchungen, erfolgt die Schadensanalyse im Hinblick auf ein baustoffliches Gutachten.
In dieser Gruppenarbeit werden komplexe Zusammenhänge interdisziplinär verstanden, gemeinsam Problemlösungen gefunden und letztlich geeignete Sanierungskonzepte erarbeitet.
→ Pflichtmodul für BWM
→ Wahlmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Materialien und Technologien für den Bautenschutz und die Instandhaltung
Nachhaltige Städte und Gemeinden erfordern widerstandsfähige und langlebige Bauten, die mit minimalem Ressourcenverbrauch instandgehalten werden können. Hier setzt dieses Modul an.
Die Kenntnis von Zusammenhängen zwischen Struktur und Eigenschaften spezieller Werkstoffe bilden die Grundlage für einen verantwortungsvollen Einsatz dieser Materialien im Bautenschutz, ebenso wie das Wissen um die geltenden technischen Vorschriften und europäischen Normen.
Schwerpunktmäßig wird die Schadensvermeidung durch Korrosionsschutz und die Schadensbehebung durch die Auswahl und die korrekte Anwendung geeigneter Materialien, insbesondere bei der Betoninstandsetzung, behandelt. Diese Kenntnisse befähigen die Studierenden selbständig Instandsetzungskonzepte zu entwickeln.
→ Pflichtmodul für BWM
→ Wahlmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Bauschäden, Schadensanalytik, Holzschutz
In nachhaltigen Städten und Gemeinden ist der Schutz von Bausubstanz ein wesentlicher Faktor, um Städte und Gemeinde nachhaltig zu gestalten. Bauschäden, die durch Umwelteinflüsse, Materialalterung oder Baufehler entstehen, können hohe Kosten und Ressourcenverbrauch nach sich ziehen. Eine fundierte Schadensanalytik ermöglicht es, solche Schäden frühzeitig zu erkennen und gezielt zu beheben, bevor umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen nötig werden.
Holz als ökologischer Baustoff wird zunehmend eingesetzt. Durch den Einsatz moderner Holzschutzmittel und -techniken können Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlinge und Pilzbefall vermieden werden. So trägt der Holzschutz zusammen mit einer effektiven Schadensanalytik dazu bei, den Gebäudebestand langfristig zu sichern und die ökologischen Vorteile von Holz als Baustoff zu maximieren.
Im Rahmen des Moduls machen sich die Studierenden mit prinzipiellen Herangehensweisen bei der Begutachtung und Ermittlung des Bauzustandes bestehender Bauwerke vertraut. Sie erlernen die Anwendung gängiger Methoden der Schadensanalyse und erhalten fachspezifische Kenntnisse zur Umsetzung baulich-konstruktiver Holzschutzmaßnahmen sowie zur Anwendung chemischer Holzschutzmittel.
→ Pflichtmodul für BWM
→ Wahlmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (M. Sc.)
Umweltingenieurwissenschaften (M. Sc.)
Klima Gesellschaft Energie
In diesem Modul wird die nachhaltige und sichere Versorgung einer imaginären Inselgesellschaft mit Wasser, Energie und Nahrung im Rahmen eines Planungsprojektes untersucht. Die Entwicklung von Gesellschaften und deren Siedlungsstrukturen werden in Abhängigkeit der klimatischen, geologischen und topographischen Bedingungen sowie der Ressourcenverfügbarkeit (Nahrungsmittel, Wasser, Baumaterial, Energieträger) analysiert. Schwerpunkte sind dabei Klimawissenschaft, Klimamodellierung und Klimaprojektionen für die Zukunft, Auswirkungen des Klimawandels, Linderung und Adaption.
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
International Case Studies in Transportation
Wie lassen sich nachhaltige Mobilität gestalten und Städte lebenswerter machen? Antworten und Kompetenzen darauf erhalten die Studierenden durch die Auseinandersetzung mit internationaler Best-Practice-Lösungen und deren Präsentation. Um ein entsprechendes Fallbeispiel in unmittelbarer Nähe zu erleben, wird den Studierenden eine Exkursion in eine ausgewählte europäische Stadt angeboten.
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Energiesystemmodellierung und Simulation
Die Betrachtung von thermischen und elektrischen Systemen sowie elektrochemischer Energiespeicher trägt zum Aufbau einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Infrastruktur bei. Im Semesterbeleg wird selbstständig ein Wasserstoffversorgungssystems auf Basis einer erneuerbaren Energiequelle entwickelt und modelliert.
→ Vertiefungsmodul für UIM Energiesysteme
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Abfallbehandlung und -ablagerung
Unter Berücksichtigung nachhaltiger Entwicklungsansätze für Städte und Gemeinden werden Anlagen zur Bio- und Restabfallbehandlung konzipiert. Die Planungsaufgabe trägt dazu bei, dass Abfälle in Übereinstimmung mit Nachhaltigkeitsprinzipien verwertet und entsorgt werden können. In den Fokus rückt hierbei:
- Wahrnehmen von Abfall als Ressource und Ermöglichen der Rückgewinnung
- Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt durch Abfallbehandlung
Der Besuch von Anlagen zur Behandlung und Ablagerung von Abfällen bietet nicht nur die Chance, die tatsächlichen Prozesse vor Ort zu erleben, sondern ermöglicht auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen in der Umsetzung.
→ Vertiefungsmodul für UIM Kreislaufwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Macroscopic Transport Modelling
Nutzung von Infrastruktur und Verkehrsverteilung werden auf den Prüfstand gestellt und auf aktuelle Gegebenheiten angepasst, sodass nachhaltige Lösungen mittels Modellierung erarbeitet werden können. Durch das Modellieren und die Simulation ist es möglich, Verkehrsfluss und -dichte bestehender Infrastruktur zu bewerten und Aussagen zu potentiellen Verkehrsmodellen mit nachhaltigem Fokus zu treffen.
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Straßenplanung
Anhand einer aktuellen Problemstellung widmen sich die Studierenden der Planung eines Straßenentwurfs nach zeitgemäßen Ansätzen, darunter wirtschaftliche Bauweise, geringer Verbrauch von Baustoffen und Energie sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel.
→ Vertiefungsmodul für UIM Mobilität und Verkehr
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Verkehrstechnik
Die Studierenden erhalten einen Überblick über mögliche Steuerungsverfahren von Lichtsignalanlagen und deren Anwendungsbereiche. Sie setzen sich kritisch mit verkehrstechnischen Fragestellungen auseinander und entwerfen selbst Signalprogramme. Aspekte wie ein optimierter Verkehrsfluss und die Bevorrechtigung von Rad- und Fußverkehr unterstützen den Weg zur nachhaltigeren Stadt.
→ Vertiefungsmodul für UIM Mobilität und Verkehr
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Infrastructure in Developing Countries
Das eigenständige Auseinandersetzen mit Problematiken mangelhafter Abfallinfrastruktur in Ländern des globalen Südens und die Erarbeitung von Lösungsansätzen sensibilisiert die Studierenden gegenüber grundlegenden Maßnahmen unter lokalen Bedingungen zu Erstellung widerstandsfähiger und nachhaltiger Infrastrukturen.
In dem semesterbegleitenden Beleg erfolgt eine Untersuchung einer existierenden Fallstudie zur Bereitstellung von Sanitäranlagen in Ländern des globalen Südens.
In diesem Zusammenhang werden Stärken und Schwachstellen analysiert, die maßgeblich zu lang- oder kurzfristigen Erfolgen der Projektergebnisse beigetragen haben. Die gewonnenen Eindrücke ermöglicht es den Studierenden, potentielle Risiken zu erkennen, zu vermeiden und Lösungskonzepte zu entwickeln, die nicht nur nachhaltig, sondern auch soziokulturell akzeptiert werden.
→ Vertiefungsmodul für UIM Kreislaufwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Stoffstrommanagement
Im Rahmen des Semesterbelegs untersuchen die Studierenden mittels Stoff- und Energiebilanz das eigene Konsumverhalten im Selbsttest. Geschult wird dadurch und mittels Visualisierung der Ergebnisse, der nachhaltige Umgang mit vorhandenen Ressourcen, wie Energie, Wasser etc.
Im weiteren Verlauf des Semesterbelegs werden Bilanzsysteme erstellt und analysiert, die an Komplexität weitaus umfangreicher sind. Daraus gewonnene Kompetenzen ermöglichen es den Studierenden an der Entwicklung nachhaltiger Systeme durch:
- Bilanzierung von Betrieben, Produktionsprozessen, Dienstleistungen etc.
- Darstellung der Prozessflüsse
- Darstellung der Umweltwirkungen (bspw. CO2-Fußabdruck)
- Beratung von Entscheidungsträgern
aktiv teilzunehmen.
→ Vertiefungsmodul für UIM Kreislaufwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Kommunale Abwassersysteme
Die Exkursionen sollen das lösungsorientierte Denken für die Ableitung von innovative Entwässerungsansätzen/ blau-grüner Infrastrukturmaßnahmen am Beispiel verschiedener Siedlungsstrukturen (Wohn-Gewerbegebiete) fördern.
Im Rahmen einer Gruppen-/ Partnerarbeit werden zudem Lösungsstrategien für ein nachhaltiges Regen-/(Ab)wassermanagement unter Berücksichtigung prozessspezifischer Parameter erarbeitet. Dabei setzen sich die Studierenden mit dem aktuellen Stand der Technik sowie Forschung auseinander. Ziel ist die Erstellung eines Konzeptpapiers und deren Präsentation.
→ Vertiefungsmodul für UIM Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Verkehrsplanung
Mobilität als Zusammenhang zwischen Aktivitäten und Ortsveränderungen wird als Schnittstelle zwischen Stadt- und Verkehrsentwicklung thematisiert. Dabei steht vor allem die umweltgerechte und nachhaltige Gestaltung der Verkehrsplanung im Fokus. Mittels des Beleges haben die Studierenden die Möglichkeit gewonnene wissenschaftliche Erkenntnisse nach außen zu spiegeln.
→ Vertiefungsmodul für UIM Mobilität und Verkehr
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Wasserstoffsysteme und Sektorenintegration
Die Vorlesungseinheiten verdeutlichen die Rolle der Integration verschiedener Sektoren für die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft (Sektorenkopplung). Die Besichtigung einer Anlage der Wasserstoffinfrastruktur fördert das Wissen hinsichtlich Funktionsprinzipien von Wasserstoffsystemen als Bestandteil einer sektorenübergreifenden Energieinfrastruktur und deren Potenziale für die Systemstabilität.
→ Vertiefungsmodul für UIM Energiesysteme
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Anaerobtechnik
Die im Semester angebotenen Exkursionen variieren unter einer Auswahl an Anlagen der Abfall- und Abwasserbehandlung mit verknüpften anaeroben Vergärungsprozessen. Bei diesen biologischen Abbauprozessen entsteht Biogas, welches bei anschließender Aufbereitung in Wärmeenergie und/oder elektrischer Energie umgesetzt wird.
Die Exkursionen schulen das Verständnis zur Funktionsweise dieser Anlagentechnik, um die Entwicklung in Richtung nachhaltige Energiebereitstellung zu fördern und somit von den fossilen Energieträgern abzurücken.
→ Vertiefungsmodul für UIM Kreislaufwirtschaft, Energiesysteme und Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Trinkwasseraufbereitung / Industrieabwasserreinigung
Durch den Besuch von Trinkwasseraufbereitungsanlagen wird den Studierenden aufgezeigt, welchen Stellenwert sauberes Trinkwasser für die Entwicklung von funktionierenden und nachhaltigen Stadtquartieren hat. Dabei werden die Herausforderungen bei der Trinkwasserversorgung deutlich, weshalb die Studierenden intelligente Lösungen für die Verteilung von Trinkwasser in Stadtquartieren kennenlernen.
→ Vertiefungsmodul für UIM Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Verkehrssicherheit I + II
Für die Exkursion wird ein Fallbeispiel ausgesucht, welches Potential für innovative Ideen zu Verbesserung der Verkehrssituation bietet. Dadurch haben die Studierenden die Möglichkeit zu erlernen, welche Maßnahmen für eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Sinne der Nachhaltigkeit und Verkehrssicherheit als sinnvoll erscheinen. Auf dem Weg zur nachhaltigeren Stadt wird die Sicherheit von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden in den Blick genommen.
→ Wahlpflichtmodul für alle Masterstudiengänge Fakultät B & U
→ 6 ECTS-Punkte
Digital Engineering (M. Sc.)
Natural Hazards and Risks in Structural Engineering (M. Sc.)
Bauphysik und energetische Gebäudesanierung (M. Sc.)
Modul Bausanierung 1 (LV Barrierefreies Bauen)
In der Lehrveranstaltung beschäftigen sich die Studierenden mit den grundlegenden Planungsmethoden des barrierefreien Bauens und Sanierens. Das zentrale Ziel des barrierefreien Bauens ist es, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen zu fördern und Ungleichheiten zu verringern. Indem Gebäude, öffentliche Plätze und Verkehrsinfrastrukturen für Menschen mit unterschiedlichen Mobilitäts-, Seh-, Hör- oder kognitiven Einschränkungen zugänglich gemacht werden, wird soziale Gerechtigkeit gefördert.
Barrierefreies Bauen trägt damit direkt zur Verringerung von Ungleichheiten und zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft bei. Um eigene praktische Erfahrungen zu sammeln, werden an einem Praxistag verschiedene Situationen selbst ausprobiert, denen Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen im alltäglichen Leben ausgesetzt sind.
→ Pflichtlehrveranstaltung für eLBau, nuBau
→ Wahllehrveranstaltung für alle berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Fakultät B & U
→ 3 ECTS-Punkte
Modul Bausanierung 2 (LV Lehmbau, Holzbau und Mauerwerksbau)
In den Lehrveranstaltungen setzen sich die Studierenden mit traditionellen Bauweisen auseinander. Es wird jeweils sowohl auf zu sanierende Objekte als auch auf Neubauobjekte eingegangen. Sanierungen bewirken weniger neue Flächenversiegelungen und senken den Rohstoffverbrauch und das Bauschuttaufkommen. Zudem wird meist mit regional verfügbaren Ressourcen gearbeitet, was auch lange Transportwege überflüssig macht.
Im Rahmen einer Projektarbeit planen die Studierenden die Sanierung eines realen Gebäudes aus Holz- und Mauerwerk. Im Rahmen einer Exkursion im Fach Lehmbau lernen die Studierenden die Vielfalt historischer Lehmbauten in Thüringen, vor allem auch im ländlichen Raum, kennen.
→ Pflichtlehrveranstaltung für eLBau, nuBau
→ Wahllehrveranstaltung für alle berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Fakultät B & U
→ 9 ECTS-Punkte (3 ECTS je Lehrveranstaltung)
Methoden und Materialien zur nutzerorientierten Bausanierung (M. Sc.)
Modul Spezialthemen Bausanierung (LV Barrierefreies Bauen)
In der Lehrveranstaltung beschäftigen sich die Studierenden mit den grundlegenden Planungsmethoden des barrierefreien Bauens und Sanierens. Das zentrale Ziel des barrierefreien Bauens ist es, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen zu fördern und Ungleichheiten zu verringern. Indem Gebäude, öffentliche Plätze und Verkehrsinfrastrukturen für Menschen mit unterschiedlichen Mobilitäts-, Seh-, Hör- oder kognitiven Einschränkungen zugänglich gemacht werden, wird soziale Gerechtigkeit gefördert.
Barrierefreies Bauen trägt damit direkt zur Verringerung von Ungleichheiten und zur Schaffung einer inklusiven Gesellschaft bei. Um eigene praktische Erfahrungen zu sammeln, werden an einem Praxistag verschiedene Situationen selbst ausprobiert, denen Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen im alltäglichen Leben ausgesetzt sind.
→ Pflichtlehrveranstaltung für nuBau, eLBau
→ Wahllehrveranstaltung für alle berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Fakultät B & U
→ 3 ECTS-Punkte
Modul Bauaufnahme und Denkmalpflege (LV Denkmalpflege)
SDG 11 fordert u. a. den Schutz des Weltkultur- und -naturerbes. Dem widmet sich die Lehrveranstaltung in besonderem Maße.
Im Rahmen eines Praktikums an einem denkmalgeschützten Objekt lernen die Studierenden die wesentlichen Abläufe beim Bewerten eines solchen Objektes und die Grundlagen für die Sanierungsplanung, die dann in weiteren Lehrveranstaltungen fachspezifisch vertieft werden.
→ Pflichtlehrveranstaltung für nuBau
→ Wahllehrveranstaltung für alle berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Fakultät B & U
→ 3 ECTS-Punkte
Modul Lehm-, Holz- und Mauerwerksbau (LV Lehmbau, Holzbau und Mauerwerksbau)
In den Lehrveranstaltungen setzen sich die Studierenden mit traditionellen Bauweisen auseinander. Es wird jeweils sowohl auf zu sanierende Objekte als auch auf Neubauobjekte eingegangen. Sanierungen bewirken weniger neue Flächenversiegelungen und senken den Rohstoffverbrauch und das Bauschuttaufkommen. Zudem wird meist mit regional verfügbaren Ressourcen gearbeitet, was auch lange Transportwege überflüssig macht.
Im Rahmen einer Projektarbeit planen die Studierenden die Sanierung eines realen Gebäudes aus Holz- und Mauerwerk. Im Rahmen einer Exkursion im Fach Lehmbau lernen die Studierenden die Vielfalt historischer Lehmbauten in Thüringen, vor allem auch im ländlichen Raum, kennen.
→ Pflichtlehrveranstaltung für nuBau, eLBau
→ Wahllehrveranstaltung für alle berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Fakultät B & U
→ 9 ECTS-Punkte (3 ECTS je Lehrveranstaltung)
Projektmanagement [Bau] (M.B.A.)
Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre
Die Studierenden sind in der Lage, grundlegende Begriffe der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre zu erklären und verschiedene Markt- und Wettbewerbsmechanismen einzuordnen. Sie lernen die strategischen und operativen Instrumente der Unternehmensbereiche Marketing, Forschung und Entwicklung, Rechnungswesen, Produktion und Personalwesen kennen und wenden diese in einer Wettbewerbssimulation an.
Durch die Wettbewerbssimulation entwickeln sie die Fähigkeit, Marktbearbeitungsstrategien zu bewerten, Konzepte wertorientierter Unternehmenssteuerung umzusetzen und Entscheidungen kritisch zu reflektieren. In Projektteams analysieren sie auftretende Probleme, diskutieren Alternativen und erarbeiten Lösungen für die nächste Simulationsrunde. In einer Abschlusspräsentation zeigen sie, dass sie wissenschaftliche Ergebnisse adressat*innengerecht darstellen und verteidigen können.
Außerdem verfügen die Studierenden über Grundkenntnisse der volkswirtschaftlichen Teilbereiche und können wirtschaftliche Entwicklungen ökonomisch einordnen, kritisch hinterfragen und Theorien auf praktische Beispiele übertragen. Darüber hinaus setzen sich die Studierenden mit ökonomischen Rahmenbedingungen auseinander, die für nachhaltige Stadtentwicklung, Ressourcenmanagement und die Schaffung lebenswerter urbaner Räume von Bedeutung sind.
→ Pflichtmodul für Projektmanagement [Bau]
→ 6 ECTS-Punkte
Kosten- und Ressourcenmanagement
Mit der Vorlesung erkennen Studierende die Notwendigkeit einer kostenmäßigen Erfassung und Bewertung der Leistungen innerhalb des Betriebes und bekommen den Aufbau geeigneter Systeme zur Kosten- und Leistungsrechnung vermittelt. Ebenso erlernen die Studierenden die Beschreibung und Analyse der betrieblichen Leistungserstellung und erkennen das Zusammenspiel damit verflochtener Funktionen wie Einkauf, Verkauf, Disposition und Lagerhaltung. Sie erhalten dadurch ein vertieftes Verständnis für die Steuerung betrieblicher Prozesse und den effizienten Einsatz von Ressourcen.
Die Studierenden analysieren, welchen Einfluss Kosten- und Leistungsrechnung auf die ressourcenschonende Gestaltung innerbetrieblicher Abläufe, die Steigerung von Effizienz und die Förderung nachhaltiger Stadt- und Gemeindestrukturen auch im Kontext betrieblicher Funktionen hat.
→ Pflichtmodul für PMM
→ 6 ECTS-Punkte
Wasser und Umwelt (M. Sc.)
WW40 - Umweltrecht
Das Modul thematisiert das Immissionsschutzrecht und das Bodenschutzrecht, die beide entscheidend für den Umweltschutz in städtischen und ländlichen Gebieten sind. Diese Gesetze helfen, Luftverschmutzung zu minimieren, Lärm zu reduzieren und Böden vor schädlichen Einflüssen zu schützen. Dies ist besonders wichtig für die Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden. Ein solider rechtlicher Rahmen stellt sicher, dass städtische Entwicklung im Einklang mit ökologischen und gesundheitlichen Standards erfolgt, was zu lebenswerteren und widerstandsfähigeren Städten führt.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Pflichtmodul für WBB-Vertiefungen
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW41 - Flussbau
Die Inhalte des Moduls befassen sich mit der naturnahen Gestaltung von Fließgewässern und der Integration von Wasserbauwerken in die Kulturlandschaft. Diese Ansätze fördern die Entwicklung nachhaltiger Städte und Gemeinden, indem sie städtische Wasserinfrastrukturen resilient und umweltfreundlich gestalten.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Wasserbau
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW44 - Gewässerentwickungsplanung
Das Modul behandelt die Integration von Fließgewässern in urbane Räume, was zur Förderung nachhaltiger Städte beiträgt. Indem Flüsse in städtischen Gebieten umgestaltet und revitalisiert werden, tragen die Maßnahmen zur Erhöhung der Lebensqualität, zur Verbesserung der Umweltbedingungen und zur Anpassung an den Klimawandel bei.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Wasserbau
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW45 - Hochwassermanagement
Das Modul fördert die Planung und Umsetzung von Hochwasseraktionsplänen und Bauleitplanungen, die zum Schutz und zur nachhaltigen Entwicklung von Städten und Gemeinden beitragen. Durch die Integration von Überschwemmungsflächen und angepassten Bauweisen werden urbane Räume widerstandsfähiger gegenüber extremen Wetterereignissen.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Wasserbau
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW50 - Management von Wasserressourcen
Das Modul befasst sich intensiv mit den Strukturen der Wasserwirtschaft in Europa und der Entwicklung sowie Umsetzung von Wasserbewirtschaftungsplänen. Diese Pläne sind entscheidend für den Schutz von Wasserressourcen und die Sicherstellung einer nachhaltigen Wasserver- und -entsorgung in städtischen Gebieten. Umweltaspekte wie Wassermanagement spielen eine zentrale Rolle bei der Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden. Die im Modul behandelten Konzepte und Strategien tragen dazu bei, dass Städte resilienter gegenüber wasserbezogenen Herausforderungen wie Überschwemmungen, Dürre und Verschmutzung werden.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Pflichtmodul für WBB-Vertiefungen
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW52 - Abwasserbehandlung
Eine clever strukturierte Abwasseraufbereitung ist v. a. in Städten für eine nachhaltige und effiziente Wasserbewirtschaftung und der Reduzierung von Auswirkungen auf die Umwelt wichtig, da:
- je nach Abwassertyp die geeignete Aufbereitung eine anschließende Verwendung vor Ort ermöglichen kann
- dadurch die Ressource Wasser gespart und der Schadstoffeintrag reduziert wird
Ziele des Moduls sind der Erwerb und die Erweiterung vertiefender Kompetenzen, die für die die Planung, den Bau und den Betrieb von Abwasserbehandlungsanlagen benötigt werden. Dabei wird im Rahmen des Kurses u. a. die Beschaffenheit des kommunalen Abwassers, die Ermittlung von Bemessungsgrundlagen, der Ablauf der verschiedenen Abwasserreinigungsverfahren, der Umgang mit Klärschlamm, sowie die Gewässerbelastung und der Gewässerschutz thematisiert. Ein sehr praxisnahes Kapitel ist dem Bau von Kläranlagen gewidmet und dient der Aneignung entsprechender Kenntnisse und Erfahrungen.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW57 - Wasserversorgungswirtschaft
Im Modul wird die Rolle der Wasserversorgung in städtischen und ländlichen Gebieten eingehend untersucht. Dazu gehören Themen wie die Planung und Optimierung von Wasserversorgungsnetzen, die Berücksichtigung von Umweltbelangen und die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen. Insbesondere wird auf die Notwendigkeit eingegangen, eine widerstandsfähige Infrastruktur zu schaffen, die auch unter den Bedingungen des Klimawandels und des wachsenden Wasserbedarfs funktioniert. Diese Themen sind zentral für die Entwicklung nachhaltiger Städte und Gemeinden, die für die langfristige Stabilität und Lebensqualität sorgen.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW58 - Wasserversorgungstechnik
Im Modul wird die Bedeutung der Wasserversorgungstechnik für die Entwicklung nachhaltiger städtischer Infrastrukturen betont. Themen wie die Optimierung der Wasserverteilung, die Sicherstellung einer zuverlässigen Wasserversorgung in städtischen und ländlichen Gebieten sowie die Integration von Wassersystemen in die städtische Planung werden behandelt. Studierende lernen, wie sie die Wasserversorgung an die Bedürfnisse wachsender Städte anpassen und gleichzeitig Umweltaspekte berücksichtigen können. Dadurch tragen sie zur Entwicklung von Städten bei, die nicht nur widerstandsfähig, sondern auch umweltfreundlich und lebenswert sind.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW92 - Neuartige Sanitärsysteme
Ein zentrales Thema des Moduls ist die Integration neuartiger Sanitärsysteme in städtische Infrastrukturen. Diese Systeme bieten innovative Lösungen für die Abwasserbewirtschaftung in urbanen Räumen, indem sie geschlossene Kreisläufe schaffen und die Umweltbelastung minimieren. Die Studierenden lernen, wie solche Systeme in städtische Planungen integriert werden können, um Städte nachhaltiger zu gestalten. Durch die Entwicklung und Anwendung dieser Technologien tragen die Studierenden dazu bei, städtische Lebensräume umweltfreundlicher und ressourceneffizienter zu gestalten.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
WW93 - Planung und Controlling in der Siedlungswasserwirtschaft
Durch die Beschäftigung mit Betreiber- und Finanzierungsmodellen sowie der Betriebs- und Organisationsoptimierung trägt das Modul zur Entwicklung effizienter und nachhaltiger städtischer Wassersysteme bei.
Im Rahmen des Kurses werden die Kursziele durch eine Kombination aus Einsendeaufgaben, Vorlesungen und Exkursionen erreicht. Die Exkursionen bieten praxisnahe Einblicke und ermöglichen die direkte Anwendung des Gelernten. Diese integrative Herangehensweise gewährleistet, dass die Lernziele umfassend und effektiv erreicht werden.
→ Wahlpflichtmodul für Vertiefung Siedlungswasserwirtschaft
→ Wahlmodul für WBB-Vertiefungen
→ 16 ECTS-Punkte
