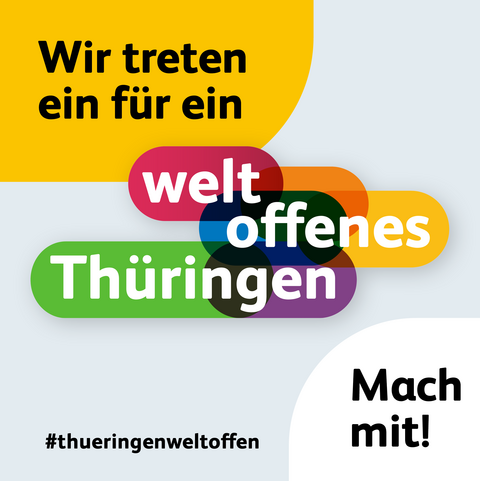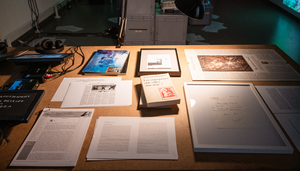Medien
Der Fachbereich Medieninformatik bietet den Bachelor-Studiengang Informatik (B.Sc.) und die englischsprachigen Master-Studiengänge Computer Science for Digital Media (M.Sc.) und Human-Computer Interaction (M.Sc.) an sowie gemeinsam mit der Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften den Studiengang Digital Engineering (M.Sc.).
Der Fachbereich Medienwissenschaft bietet die Studiengänge Medienkultur (B.A.) und Medienwissenschaft (M.A.) sowie die Studienprogramme Europäische Medienkultur (B.A./L.I.C.) und Filmkulturen: Extended Cinema (M.A.) an.
Der Fachbereich Medienmanagement bietet den Master-Studiengang Medienmanagement (M.A.) an.