
Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. DASL
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
10.2011-01.2016
Berufliche Erfahrung
seit 2017 Referent für Städtebauliche Denkmalpflege, Landesdenkmalamt Berlin
2016 Referent für Baukultur und EU-Förderung, TMIL
2011-2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bauhaus-Universität Weimar
2010-2011 Referent für Kommunalpolitik, Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen
2006-2010 Baurat, Regierung von Oberbayern
2004-2006 Referendar der Fachrichtung Städtebau, Freistaat Bayern
1999-2003 Tutor, TU Berlin
Ausbildung
seit 2012 Doktorand, Bauhaus-Universität Weimar
2004-2006 Referendar der Fachrichtung Städtebau, Freistaat Bayern
1999 Erasmus-Semester an der Università d.s. Federico II, Neapel
1996-2003 Studium der Stadt- und Regionalplanung, TU Berlin
1993-1996 Studium der Architektur, TU München
Weitere Aktivitäten
seit 2018 Mitglied der Deutschen Akademie für
Städtebau und Landesplanung (DASL) mehr
seit 2014 Mitglied des AK "Zeitgerechte Stadt" der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL) mehr
seit 2012 Gründungsmitglied und Sprecher des Denkmalnetzes Bayern
Deutscher Preis für Denkmalschutz 2013
www.denkmalnetzbayern.de
seit 2007 Internationale Lehrerfahrung durch Lehraufträge, Workshops und Vorträge
u.a. Tsinghua University Beijing (China), MGSU Moskau (Russland),
GUTech Maskat (Oman), TU Berlin-El Gouna (Ägypten),
Oxford Brookes University (UK), University of Liverpool (UK)
Artikel in Fachzeitschriften und Sammelbänden
Bürgerbeteiligung, in: Eidloth, Volkmar et. al. im Auftrag der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VDL) (Hg.): Handbuch Städtebauliche Denkmalpflege. Petersberg 2019, S. 237-238 mehr
Mehrfach:Nutzen – Mehrfachnutzung und Space Sharing als Strategie zur nachhaltigen Stadtentwicklung, in: Henckel, Dietrich; Kramer, Caroline (Hg.): Zeitgerechte Stadt – Konzepte und Perspektiven für die Planungspraxis. Forschungsberichte der ARL 09. Hannover 2019, S. 203-222 mehr
Denkmalpflege, Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement - Zeit für eine Neujustierung, in: Die Denkmalpflege 1/2017, S. 27-32 mehr
"Altstadtfreunde". Bürgerschaftliches Engagement für Denkmal- und Stadtbildpflege, in: Enss, Carmen und Gerhard Vinken (Hg.): Produkt Altstadt: Historische Stadtzentren in Städtebau und Denkmalpflege. Bielefeld 2016, S. 257-270 mehr
Stadtbild, Denkmäler und Nicht-Denkmäler, in: Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) (Hg.): Stadtbilder - Stadterzählungen. Bonn 2015, S. 12-18 mehr
Heritage Governance – Zur Rolle des bürgerschaftlichen Engagements in der englischen Denkmalpflege, in: Landesdenkmalamt Berlin (Hg.): Zwischen Welterbe und Denkmalalltag – erhalten, erschließen, engagieren. Dokumentation der Jahrestagung 2014 (Vereinigung der Landesdenkmalpfleger VdL). Berlin 2015, S. 380-383 mehr
Values and volunteers - How civic organisations shape the conservation discourse in the UK, in: Franz, Birgit und Gerhard Vinken (Hg.): Denkmal - Werte - Bewertung. Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege. Holzminden, Band 23/2014, S. 94-101 mehr
Behutsamkeit für die Nachkriegsmoderne?, in: Altrock, Uwe et al. (Hg.): Das Ende der Behutsamkeit? Jahrbuch Stadterneuerung 2013. Berlin 2013, S. 145-159 (mit Julia Drittenpreis und Hana Riemer) mehr
Die moderne Architektur in Island in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Rezension des Buches von Atli Seelow), in: Detail 4/2012, S. 300 mehr
Geordneter Rückzug oder Less is more?, in: vorgänge 161/2003, S. 41-50 (mit Thilo Lang und Sascha Vogler) mehr
Stadtumbau und Spaß dabei!, in: Planungsrundschau 5/2002, S. 184-188 mehr (Sektion Rundschau)
Graue Literatur und journalistische Beiträge
Vox Pop, Interview in: Context - Institute of historic building conservation 157/2018, S. 64 mehr
Grußwort, in: Denkmalgeschützte Häuser in Tutzing. Katalog zur Ausstellung. Tutzing 2018, S. 8-9 mehr
Temporär, informell, hybrid – neue Nutzungsformen, in: Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (Hg.): „Mischung und Dichte“ - der Dialog von Wissenschaft und Praxis. Ergebnisbericht des 5. Hochschultags der Nationalen Stadtentwicklungspolitik 2016. Berlin 2016, S. 26-27 (mit Lena Flamm und Moritz Maikämper) mehr
Aus dem Erbe Zukunft machen. Das Denkmalnetz Bayern, in: Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) (Hg.): Baukultur und Denkmalpflege vermitteln. Beispiele, Methoden, Strategien. Bonn 2013, S. 73-76 (mit Meike Gerchow und Johannes Haslauer) mehr
Denkmalnetzwerk Bayern, in: Schönere Heimat 3/2011, S.264 mehr
Infobriefe Planen und Bauen der Regierung von Oberbayern mehr
(gemeinsam mit der Projektgruppe Sonderaufgaben Städtebau )
- Infobrief 9: Baukultur Teil 1: Beratung - Öffentlichkeit – Wettbewerbe, München 2010
- Infobrief 8: Solaranlagen gut gestaltet, München 2008
- Infobrief 7: Modernisierung von Wohnraum, München 2008
- Infobrief 6: Energieeffizientes Bauen, München 2007
Alte Pinakothek, Building of the month July 2005, 20th Century Society (online) mehr
Landhaus Enterprise, in: Die Welt, 31.3.2005 mehr
Kultivierte Schrumpfung, in: taz, 22.9.2002 mehr
Vorträge (Auswahl)
Space Sharing is the answer, but what was the question? Moderation des Abschlusssymposiums des Reallabors Space Sharing der ABK Stuttgart, Stuttgart 14.6.2018 mehr
Denkmalpflege und Bürgerbeteiligung: Chancen und Risiken. Jahrestagung 2018 der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, Trier 12.6.2018 mehr
Mehrfach:Nutzen. Workshop Circular Economy der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), Stuttgart 9.5.2018 mehr
Temporär, informell, hybrid – neue Nutzungsformen. Einleitung zum Forum B, 5. Hochschultag der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Berlin 1.7.2016 mehr
Besonders erhaltenswert in Berlin - ein Projekt zur Auswahl und Bestimmung erhaltenswerter Bausubstanz. Tagung Gemeinschaftsaufgabe Stadtplanung und Denkmalschutz, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 29.6.-30.6.2016 mehr
Stadtbildprägende Bausubstanz: Denkmale und Nicht-Denkmale. Tagung Stadt | Bild | Pflege, BHU, Nürnberg 8.-9.10.2015 mehr
"Altstadtfreunde" - Bürgerschaftliches Engagement. Tagung Produkt Altstadt – The Making of the Old Town, Otto-Friedrich-Universität Bamberg 7.-9.5.2015 mehr
Stadtentwicklung und Wohnen als Ausbildungsgegenstand und Thema von Nachwuchsforschung. Podiumsdiskussion, 4. Hochschultag der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Berlin 21.11.2014 mehr
Mehrfach:Nutzen. Workshop zum Reallabor Space Sharing, Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 23.7.2014 mehr
Die "besonders erhaltenswerte Bausubstanz". Expertenhearing der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 18.6.2014
Heritage Governance - Zur Rolle bürgerschaftlichen Engagements in der englischen Denkmalpflege. Jahrestagung 2014 der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger, Berlin 3.6.2014 mehr
Multiple use in the shared City. SCUPAD | Salzburg Congress on Urban Planning and Development 17.5.2014 mehr
Energy Policy and the planning and building sector in Germany. Guest Lecture, Oxford Brookes University 13.5.2014
Denkmalpflege und Zivilgesellschaft. Tagung Digitaler Sakralbauatlas, Weimar 21.3.2014 mehr
Zivilgesellschaft in der Denkmalpflege - Hoffnungsträger oder Störenfried? Kolloquium Erhalten! - Für wen?, Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 19.3.2014 mehr
Values and volunteers. Tagung Denkmal-Werte-Bewertung, AK Theorie und Lehre der Denkmalpflege, BTU Cottbus 1.11.2013 mehr
Räume für Kultur und Kulturwirtschaft. Öffentliche Anhörung der Stadtratsfraktion B90/Die Grünen, Jena 30.5.2013 mehr
Schrumpfung: Regionen im Wandel. Einführung zum Symposium Thüringen | International, Bauhaus-Universität Weimar 13.12.2012 mehr
English lessons for Russia and Germany? Podiumsdiskussion (mit Chris Costelloe/London und Elena Minchenok/St.Petersburg), Denkmalmesse Leipzig 23.11.2012 mehr
Herausforderungen der energetischen Quartiersentwicklung. Wohnraumkonferenz der Thüringer Landtagsfraktion B90/Die Grünen, Jena 6.11.2012 mehr
NGOs in conservation. International NGO Forum to the World Heritage Committee meeting, St.Petersburg 22.6.2012 mehr
Behutsamkeit für die Nachkriegsmoderne? Tagung Die Zukunft der Behutsamkeit, Universität Kassel 14.6.2012 mehr
Zivilgesellschaft und Baukultur. Moderation der AG im Forum A, 3. Hochschultag der Nationalen Stadtentwicklungspolitik, Berlin 27.4.2012 mehr
Wieviel Materie braucht Geschichte? Der Substanzbegriff in der städtebaulichen Denkmalpflege. Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung, Berlin 30.11.2011 mehr
Heritage Governance. Konferenz Urban development and politics in Europe and Russia, St.Petersburg 30.10.2011 mehr
Vorbild England. Was kann die bürgerschaftliche Denkmalpflege von England lernen? Tagung Bürgerinitiativen im Denkmalschutz, Evangelische Akademie Tutzing, 3.6.2011 mehr
Planungsprojekt: Energetische Modernisierung: Planung zwischen Pelletheizung, Politik und Polemik
5.+7. Fachsemester | Achim Schröer | 8 SWS, 12 ECTS
Do. 09:15 - 16:45 Uhr | Beginn: 15.10.2015
Energiewende und Klimaschutz stellen Stadtplanung und Architektur vor hohe Herausforderungen. Der Gebäudebereich, und hier besonders die Modernisierung des Bestandes, birgt hohe Potentiale zur Einsparung und auch zur regenerativen Erzeugung von Energie. Aspekte von Technik, Wirtschaftlichkeit, Sozialverträglichkeit, Gestaltung und nicht zuletzt Politik und Steuerung erfordern dabei interdisziplinäre Kompetenz. Anhand von Fallbeispielen aus Thüringen und Deutschland sollen typische Problemlagen untersucht und Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden.
Es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Baumeister CampusLab - Wettbewerb "Moving On II - Smart City".
Planungsprojekt: Eine Zukunft für die 50er - Weiterentwicklung von Nachkriegs-Siedlungen in Nürnberg
2. Fachsemester | Achim Schröer | 8 SWS, 12 ECTS
Di 09:15 – 16:45 Uhr | Beginn: 07.04.2015
Die Siedlungen der 1950er Jahre, damals schnell und zahlreich gebaut, prägen viele westdeutsche Städte. Sie besetzen heute eine gewisse Nische auf den Wohnungsmärkten, weisen aber einen hohen Modernisierungsbedarf auf; auch die Option Abriß und Neubau wird dabei diskutiert. An Siedlungsbeispielen in der nordbayerischen Großstadt Nürnberg sollen die Gemengelagen aus Wohnungsmarkt, Stadtentwicklung, Städtebau und Architektur analytisch sowie konzeptionell und entwurflich untersucht werden.
Planungsprojekt: Leinefelde Zentrum - Zentrum Leinefelde

1. Fachsemester | Arvid Krüger, Achim Schröer | 2 SWS, 3 ECTS
Di. 09:30 - 15:00 Uhr + Sondertermine freitags*| Beginn: 21.10.2014
Die Stadt Leinefelde-Worbis im Norden Thüringens ist das Paradebeispiel für eine schrumpfende Stadt, die sich schon früh der Herausforderung des „Stadtumbaus“ gestellt hat. Mit der wegbrechenden industriellen Basis und einem Baubestand von über 90% „Plattenbauten“ aus der DDR wird bereits seit 1994, und verstärkt im Rahmen des Stadtumbau-Programms ab 2002, für die demographische und bauliche Schrumpfung der Stadt geplant. Nach 20 Jahren ist einerseits ein Resumée zu ziehen, andererseits verlangen neue Rahmenbedingungen und Leitbilder nach einer neuen Justierung. Insbesondere die Frage des Zentrums soll im Vordergrund stehen und in relevanten Aspekten analysiert werden: Städtebau, öffentlicher Raum, Erreichbarkeit, Einzelhandel und soziale Infrastruktur wie z.B. Schule bilden Bausteine einer möglichen Neukonzeption des Leinefelder Zentrums.
Dabei soll auch die Rolle des Zentrums von Leinefelde – bzw. Leinefeldes als regionales Zentrum – in der Region anhand sektoraler Fragestellungen wie Schulnetzplanung, Bahnverkehr und Energie thematisiert werden.
Ziel ist ist es, anhand der neu aufgeworfenen Stadt-Land-Debatte (IBA Thüringen) am Beispiel Leinefelde sowohl die diskursive Seite der Stadt (Zentrum Leinefelde) als auch des Lands (Leinefelde als Zentrum) zu beleuchten.
*Sondertermine freitags:
- 14.11.2014
- 28.11.2014
- 19.12.2014
- 09.01.2015
- 23.01.2015
Planungsprojekt: Jena: Wohnen in der wachsenden Stadt
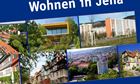
1. Fachsemester | Achim Schröer | 8 SWS, 12 ECTS
Di. 10:00-16:00 Uhr | Beginn: 15.10.2013
Während in vielen Regionen Ostdeutschlands von Schrumpfung gesprochen wird, wächst die Bevölkerung in den Städten der Thüringer „Impulsregion“, in Erfurt, Weimar und Jena: Es wird dort knapp am Wohnungsmarkt. Gleichzeitig wird bundesweit von einer Reurbanisierung gesprochen und damit von einer Wiederentdeckung der Attraktivität (inner)städtischer Lebensformen. Im Planungsprojekt soll diese „neue Wohnungsfrage“ am Beispiel der Stadt Jena untersucht werden: Was sind die treibenden Kräfte und welche Herausforderungen bestehen am Jenaer Wohnungsmarkt? Was bedeutet dies stadträumlich, welche Typologien sind besonders interessant? Wie reagieren städtische Politik und Verwaltung, welche Instrumente und welche Akteure spielen dabei eine Rolle? Aufbauend auf einer Analyse sollen Lösungskonzepte entwickelt werden, die die ganze Bandbreite der Wohnungsfrage von institutionellen Fragen bis zum Städtebau integrieren.
Planungsprojekt: MEHRFACH:NUTZEN
7. Fachsemester | Achim Schröer | 8 SWS, 12 ECTS
Do. 10:00-16:00 Uhr | Beginn: 12.10.2012
Gebäude, Stadträume und Infrastrukturen bieten meist Kapazitäten für Nutzungen und Nutzungsdichten, die nur selten stattfinden oder erreicht werden. Funktionstrennung, Wohlstand und Massenmobilität haben in Mitteleuropa eine Stadtstruktur entstehen lassen, die weithin untergenutzt bzw. überdimensioniert ist: Arbeits- oder Freizeitstätten stehen den Großteil ihrer Zeit leer, Infrastrukturen sind an Spitzenlasten bemessen, die teils nur wenige Minuten täglich andauern, sogar Wohnungen sind je nach Lebenssituation lange Zeit faktisch unbewohnt. Die Diskussionen um eine effizientere Nutzung von Ressourcen einerseits (Energie, Landschaftsraum oder auch Kapital) und um die vielbeschworenen Werte der Europäischen Stadt andererseits (Dichte, Nutzungsmischung, Urbanität) werfen die Frage auf, ob eine effizientere Nutzung und Auslastung von Räumen und Infrastrukturen sinnvoll und möglich ist. In Analogie zur in den letzten Jahren im Produktdesign entstandenen Diskussion um „Nutzen statt besitzen“ könnte ein Ansatz dazu eine zeitlich gestaffelte Mehrfachnutzung sein, wie sie in Ansätzen schon praktiziert wird: Wohnungen werden über den eigenen Urlaub weitervermietet, Schulräume werden nachmittäglich durch Musik- und Volkshochschulen genutzt, flexible Büros reduzieren die Anzahl von Büroarbeitsstätten. In einem wachsenden und unter Nutzungsdruck stehenden Ballungsraum wie z.B. München sollen anhand von Beispielen aus verschiedenen Sektoren (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Verkehr, Energie …) Nutzungsrhythmen, Potentiale für Mehrfachnutzungen und Umsetzungsmöglichkeiten dafür untersucht werden. Die Bandbreite kann dabei von institutionen- und verfahrensorientierten Konzepten (z.B. Mehrfachnutzungsagenturen, Wochenendpendler-Börsen) bis zu konkreten Entwürfen (z.B. Sport/Parkplätze, flexible Ladeneinrichtungen) reichen. Technische, gestalterische, rechtliche und wirtschaftliche Probleme sind dabei zu lösen. Das Projekt dient der inhaltlichen Vorbereitung der Winterschule "Zeitgerechte Stadt", die Anfang März 2013 im Rahmen des Projektes "Fachlicher Nachwuchs entwirft Zukunft" des BMVBS/BBSR stattfindet.
Wahlmodul: Winterschule Zeitgerechte Stadt
7. Fachsemester, nur 3 TN aus dem PlanPro "Mehrfach:Nutzen"| Achim Schröer | 4 SWS, 6 ECTS | ab März 2013
Die Winterschule „Zeitgerechte Stadt” findet im Anschluss an das Planungsprojekt „Mehrfach:Nutzen” statt im Rahmen einer interdisziplinär und hochschulübergreifend angelegten Kooperation unter der Leitung der TU Berlin und der BTU Cottbus. Lehrstühle der planenden Disziplinen führen im Anschluss an Semesterprojekte diese Winterschule für Studierende durch. Ziel ist es, die Perspektive der jungen Generation, des fachlichen Nachwuchses, zu einem festen Bestandteil eines fachlichen Dialogs im Kontext der nationalen Stadtentwicklungspolitik werden zu lassen. Die Winterschule findet Anfang März 2013 im Rahmen des Projektes „Fachlicher Nachwuchs entwirft Zukunft” des BMVBS/BBSR statt. Zur Winterschule werden maximal drei Studierende aus dem Planungsprojekt entsandt.
Planungsprojekt: Altersgerechtes Wohnen in Weimar
2. Fachsemester | Ulla Schauber und Ulrike Jurrack; Idee und Begleitung: Achim Schröer | 8 SWS, 12 ECTS | Do. 09:15-16:45 Uhr | Beginn: 18.10.2012
Der demographische Wandel stellt Städte vor neue Herausforderungen. Er öffnet einmal mehr den Blick dafür, daß die Bedürfnisse an den Stadtraum auch vom Lebensalter und der Lebenssituation abhängig sind: Kinder, Jugendliche, Singles, Familien oder Senioren stellen jeweils ganz unterschiedliche Ansprüche an Wohnungen, Wohnumfeld, Nahversorgung und Mobilität. Im Planungsprojekt werden an bestehenden Beispielen in Thüringen mehrere Siedlungstypen - z.B. Altstadt, Gründerzeitviertel, Großsiedlung, Einfamilienhausgebiet oder Dorf - untersucht und analysiert, in Form von übergeordneten Konzepten und räumlichen Masterplänen werden Möglichkeiten zu ihrer Qualifizierung erarbeitet. Durch das Projekt erhalten die Studierenden grundlegende Einblicke in die Zusammenhänge von Form und Gebrauch städtischer Strukturen, erarbeiten planerische Lösungen und lernen nebenbei ihre neue Studiengegend kennen. Das Projekt nimmt am Studierendenwettbewerb "Altersgerecht Bauen und Wohnen - Barrierefrei, quartierbezogen, integrativ" des BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) teil und erfährt zusätzlichen Anregung durch den Austausch mit einem Entwurfsprojekt der Professur für Entwerfen und Wohnungsbau zum selben Wettbewerb.
Planungsprojekt: I muaß no in d'Stodt
2. Fachsemester | Achim Schröer, Albrecht Erbring | 8 SWS, 12 ECTS
Do. 09:15 – 16:45 Uhr | Beginn: 05.04.2012
Suburbanisierung ist ein beherrschendes Thema der Stadtentwicklung seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine der großen Planungsaufgaben heute liegt im Umgang mit ihren Folgen und der Adaption suburbaner Räume an veränderte soziale, wirtschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen. Die Beschäftigung mit dem verstädterten Raum der Metropolregion jenseits der Kernstadt bietet die Chance, sowohl eine Stadtregion als Gesamtraum zu verstehen wie auch kleinteilige lokale Lösungen zu erarbeiten. Dabei spielt die Gestaltung der suburbanen Zentren als Räume mit eigener Qualität und Attraktivität eine besondere Rolle. Diesem Thema wird sich das Projekt am Beispiel der Metropolregion München nähern: München als dritte Millionenstadt Deutschlands und wirtschaftliche Wachstumsregion ist seit 1945 rasant gewachsen. Insbesondere waren dadurch die Umlandgemeinden außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen betroffen, ohne dass deren Ortszentren adäquat mitgewachsen wären. Es stellt sich nun die Frage nach einer sinnvollen Verteilung von Zentrumsfunktionen in der Metropolregion, deren Lösung eine funktionale und städtebauliche Nachqualifizierung dieser Ortskerne sein könnte.
Planungsprojekt: Shared Space Erfurter Straße
1. Fachsemester | Harald Kegler, Achim Schröer, Albrecht Erbring | 8 SWS, 12 ECTS | Do. 09:15-16:45 Uhr | Beginn: 20.10.2011
Das Planungsprojekt dient der konkreten Einführung in die stadtregionale Planung auf den Ebenen von Parzelle bis Stadtteil/Gesamtstadt. In dieser ersten „spielerischen" Annäherung an das zukünftige Berufsfeld der Urbanisten werden die Studierenden am Beispiel der wichtigsten Ausfallstraße von Weimar, der „Erfurter Straße", die wichtigsten Themen der Stadtplanung exemplarisch kennen lernen. Dabei wird ein Verständnis von Komplexität, Ganzheitlichkeit und Historizität der Stadt und ihrer Teilbereiche angeregt. Die „Radiale" bildet einen städtebaulichen Raum zwischen Kernstadt und Peripherie und dient als ein ideales Mittel zum Erkunden und Planen. Es werden Räume analysiert, Konfliktsituationen und Brüche in der Stadt herausgearbeitet und Einblicke in die dahinter liegenden verschiedenen Planungssituationen (z. B. im Zusammenhang mit dem aktuellen Stadtentwicklungskonzept Weimar 2030) gewonnen. Es geht darum, beispielhaft zu verstehen, mit welchen Situationen eine Stadtplanerin/ein Stadtplaner umzugehen hat. Auf dieser Grundlage erster Einsichten in die planerischen Zusammenhänge der Stadt vertiefen wir im Folgenden ausgewählte, konkrete städtebauliche Situationen in Weimar. Dazu werden wichtige Methoden der Planung angewandt und erste Fantasien für eine planerische Veränderung entwickeln. „Shared Space" dient der Entwicklung eines neuen Planungsansatzes ... Das Ziel besteht darin, ein Gespür für die Dimensionen planerischer Tätigkeit, deren fachliche Grundlagen, aber auch die Freude am Planen zu erlangen.
Seminar: Planungssteuerung


Im Zentrum des Seminars „Planungssteuerung“ steht die Frage, inwieweit räumliche Entwicklung angesichts konfligierender gesellschaftlicher Interessen und der hohen Komplexität planerischer Aufgaben mit den gegebenen Instrumenten, Methoden und Verfahren der Stadtplanung gesteuert werden kann und soll. Berücksichtigt werden dabei insbesondere die Besonderheiten der verschiedenen Planungsebenen, regionale und nationale Differenzen sowie die Rolle und das Zusammenspiel der unterschiedlichen beteiligten Akteure aus Markt, Zivilgesellschaft und Staat. Besonderes Augenmerk richtet das Seminar dabei auch auf die Rolle der institutionalisierten Stadtplanung sowie der planenden Experten.
Es kann gewählt werden zwischen zwei Seminaren. Bei Ungleichverteilung entscheidet das Los.
Wettbewerb, Beteiligung, Kooperation – Planungsstrategien in europäischen Städten und Stadtregionen
4. Fachsemester | Barbara Schönig | 2 SWS, 3 ECTS
Mo. 09:15 - 10:45 Uhr | Beginn: 07.04.2014
Vor dem Hintergrund planungstheoretischer Literatur untersucht das Seminar anhand von Fallbeispielen Stadtentwicklungsstrategien europäischer Großstädte und Stadtregionen. Diskutiert wird nicht nur, welche planerischen und gesellschaftlichen Ziele mit Stadtentwicklungsstrategien verfolgt werden und wie diese räumlich umgesetzt werden. Wesentlicher Gegenstand des Seminars sind die Planungsverfahren und -instrumente, mit denen sie erarbeitet und konsensfähig gemacht werden sollen, die Rolle unterschiedlicher Akteure in den Verfahren und die Wirkungsmacht, die durch diese Formen der Steuerung von Stadtentwicklung entfaltet werden kann.
Thüringer Planung zwischen Paragraphen, Politik und Partizipation
4. Fachsemester | Achim Schröer | 2 SWS, 3 ECTS
Mi. 11:00 - 12:30 Uhr | Beginn: 09.04.2014
Stadt- und Regionalentwicklung entsteht im Zusammenwirken von mehreren Akteuren, von Politik und Verwaltung, aber auch von Bürgern und Wirtschaft. In den verschiedenen Planungsfeldern haben sich dabei ganz unterschiedliche formelle und informelle Verfahren und Mitwirkungsmöglichkeiten etabliert. Aufbauend auf planungstheoretischen Diskursen sowie der Vorstellung einzelner Akteure soll dieses Zusammenspiel anhand von Thüringer Beispielen analysiert werden.
Seminar: Planungssteuerung
4. Fachsemester | 2 SWS, 3 ECTS
Im Zentrum des Seminars „Planungssteuerung“ steht die Frage, inwieweit räumliche Entwicklung angesichts konfligierender gesellschaftlicher Interessen und der hohen Komplexität planerischer Aufgaben mit den gegebenen Instrumenten, Methoden und Verfahren der Stadtplanung gesteuert werden kann und soll. Berücksichtigt werden dabei insbesondere die Besonderheiten der verschiedenen Planungsebenen, regionale und nationale Differenzen sowie die Rolle und das Zusammenspiel der unterschiedlichen beteiligten Akteure aus Markt, Zivilgesellschaft und Staat. Besonderes Augenmerk richtet das Seminar dabei auch auf die Rolle der institutionalisierten Stadtplanung sowie der planenden Experten. Es kann gewählt werden zwischen zwei Seminaren:
Wettbewerb, Beteiligung, Kooperation – Planungsstrategien in der postfordistischen Stadt(-region)
Barbara Schönig | Mo. 9:15-10:45 | Beginn: 29.04.2013
Vor dem Hintergrund planungstheoretischer Literatur untersucht das Seminar anhand von Fallbeispielen Stadtentwicklungsstrategien europäischer Großstädte und Stadtregionen. Diskutiert wird nicht nur, welche planerischen und gesellschaftlichen Ziele mit Stadtentwicklungsstrategien verfolgt werden und wie diese räumlich umgesetzt werden. Wesentlicher Gegenstand des Seminars sind die Planungsverfahren und -instrumente, mit denen sie erarbeitet und konsensfähig gemacht werden sollen (z.B. Großprojekte, Masterpläne, Stadtforen …), die Rolle unterschiedlicher Akteure in den Verfahren und die Wirkungsmacht, die durch diese Formen der Steuerung von Stadtentwicklung entfaltet werden kann.
Thüringer Planung zwischen Paragraphen, Politik und Partizipation
Achim Schröer | Do. 9:15-10:45 | Beginn: 11.04.2013
Stadt- und Regionalentwicklung entsteht im Zusammenwirken von mehreren Akteuren, von Politik und Verwaltung, aber auch von Bürgern und Wirtschaft. In den verschiedenen Planungsfeldern haben sich dabei ganz unterschiedliche formelle und informelle Verfahren und Mitwirkungsmöglichkeiten etabliert. Aufbauend auf planungstheoretischen Diskursen sowie der Vorstellung einzelner Akteure soll dieses Zusammenspiel anhand von Thüringer Beispielen analysiert werden.

